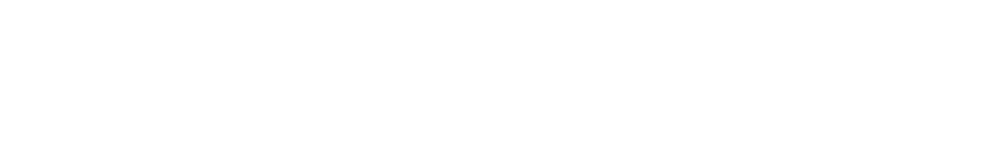| (GZ-8-2025 - 10. April) |
 |
► Deutscher Landkreistag und Deutscher Städtetag: |
Kommunalen Motor am Laufen halten |
Der Deutsche Landkreistag (DLT) hat erneut auf die Notwendigkeit hingewiesen, strukturelle Lösungen für die anhaltenden finanziellen und organisatorischen Probleme auf kommunaler Ebene zu finden. Im Rahmen einer Präsidiumssitzung im niedersächsischen Jever (Landkreis Friesland) verdeutlichte DLT-Präsident, Landrat Dr. Achim Brötel, dass die kommunalen Verwaltungen in Deutschland unter einem enormen Druck stünden und dringend Unterstützung benötigten.
Die Situation sei wie bei einem Schiff, das immer schwerer ins Wasser gedrückt werde und zunehmend Schwierigkeiten habe, sich fortzubewegen, betonte Brötel. „Die Bundes- und Landespolitik hat die kommunale Ebene in den letzten Jahren massiv überlastet. Allein im vergangenen Jahr mussten die Städte, Landkreise und Gemeinden ein Defizit von mehr als 20 Milliarden Euro verkraften. Ein solches Minus war bisher noch nie der Fall. Und die Lage verschärft sich weiter, bedingt durch teure Tarifabschlüsse und steigende Sozialausgaben. Wenn der kommunale Motor ins Stottern gerät oder gar ganz ausfällt, wären wir handlungsunfähig – und das muss unbedingt verhindert werden.“
Investitionsprogramme
DLT-Vizepräsident, Landrat Sven Ambrosy, unterstrich die Forderung nach Investitionsprogrammen auf kommunaler Ebene. Noch wichtiger aber sei es, die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen zu beheben. „Es muss endlich Schluss sein mit der chronischen Unterfinanzierung. Überflüssiger Ballast muss abgebaut werden, und es müssen deutlich mehr Steuermittel für die Grundfinanzierung der Kommunen zur Verfügung gestellt werden“, erklärte Ambrosy.
Stärkung der Finanzkraft
Der Deutsche Landkreistag fordert daher eine nachhaltige Stärkung der Finanzkraft der Kommunen. Dies würde nicht nur zu einer besseren Grundversorgung führen, sondern auch mehr Spielraum für selbstbestimmte Investitionen bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, verlangt der Verband eine Verdreifachung des kommunalen Umsatzsteueranteils auf jährlich etwa 11 bis 12 Milliarden Euro. Nur so könne verhindert werden, dass die Kommunen weiter in die Schuldenfalle geraten und zunehmend handlungsunfähig werden, machte Brötel deutlich.
Das milliardenschwere „Sondervermögen Infrastruktur“ des Bundes wird als ein wichtiger Schritt anerkannt, ist aus Sicht des DLT jedoch nur dann effektiv, wenn die Mittel den Kommunen schnell und unbürokratisch zur Verfügung gestellt werden. Brötel kritisierte die langwierigen Antrags-, Vergabe- und Nachweisverfahren, die die Umsetzung von Projekten unnötig verzögerten.
Nachhaltige Lösung
Neben Investitionen sei jedoch auch eine nachhaltige Lösung für die dauerhaft unzureichende Finanzierung der kommunalen Grundlasten erforderlich. „Die chronische Unterfinanzierung muss endlich behoben werden, damit die Kommunen nicht handlungsunfähig werden“, so der Präsident. Er verwies darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger den Staat vor allem auf der kommunalen Ebene wahrnähmen und es unerlässlich sei, diese weiterhin funktionsfähig zu halten.
Deutlich mehr Unterstützung vom Bund erwarten die Landkreise für die Erfüllung sozialer Aufgaben. Der Bund hatte bis Ende 2021 die Unterkunftskosten für Geflüchtete vollständig übernommen, doch seit 2022 erhalten die Kommunen nur noch einen Teil der Kosten erstattet, was mittlerweile zu einem Defizit von 8,4 Milliarden Euro führt. Der DLT fordert daher eine deutliche Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Sozialausgaben, insbesondere in Bereichen wie dem Bürgergeld und der Kinder- und Jugendhilfe. „Jährliche Ausgabesteigerungen von über 15 Prozent, wie sie aktuell in diesen Bereichen zu beobachten sind, können von keinem Haushalt langfristig verkraftet werden“, stellte Brötel fest.
Krankenhäuser finanzieren
Zusätzlich müssten Krankenhäuser, die für die Versorgung der Bevölkerung notwendig sind, auskömmlich finanziert werden. Der DLT-Chef kritisierte die jüngste Krankenhausstrukturreform als unzureichend und forderte einen rückwirkenden Inflationsausgleich. „Die flächendeckende Gesundheitsversorgung darf nicht zum Spielball von Insolvenzen werden. Das betrifft nicht nur die gesundheitliche Versorgung, sondern auch die Verteidigungsfähigkeit und den Zivilschutz in Deutschland.“
Darüber hinaus wies Brötel auf die Notwendigkeit hin, die Planungs-, Genehmigungs- und Vergabeverfahren für Investitionen zu beschleunigen. Ein Beispiel sei das Konjunkturpaket von 2009, das durch Vereinfachungen bei der Vergabe von Bauaufträgen und der Verkürzung von Genehmigungsprozessen die Umsetzung von Projekten beschleunigte. „In den letzten Jahren ist die Dauer von Vergabeverfahren von 62 auf 96 Tage gestiegen – eine Verlängerung um mehr als 50 Prozent. Wir brauchen dringend mehr Freiheiten und weniger bürokratische Hürden“, unterstrich der Präsident.
Bei seiner Präsidiumssitzung in Münster hat der Deutsche Städtetag die potenziellen Koalitionäre im Bund aufgefordert, ein neues Miteinander von Bund, Ländern und Kommunen zu etablieren. Zu den laufenden Koalitionsverhandlungen von CDU/CSU und SPD erklärte der Präsident des Deutschen Städtetages, Oberbürgermeister Markus Lewe aus Münster: „In den vergangenen Wochen haben wir von der Bundesebene oft gehört, dass die Handlungsfähigkeit der Kommunen gestärkt werden soll. Daran wird sich die neue Bundesregierung messen lassen müssen.“
Infrastruktur-Sondervermögen
Ein wichtiges Signal in Richtung einer besseren Zukunft sei das Infrastruktur-Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, das explizit für Länder und Kommunen bereitgestellt werde. Lewe unterstützt diese Maßnahme und forderte, dass die Mittel schnell und unkompliziert vor Ort ankommen. Neben den 100 Milliarden Euro für Kommunen und Länder sowie den 100 Milliarden Euro für den Klima- und Transformationsfonds sei es wichtig, dass auch ein großer Teil der übrigen 300 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen vor Ort eingesetzt wird.
In ihrem Sondierungsergebnis hatten sich CDU/CSU und SPD darauf geeinigt, verstärkt in Bildung, Gesundheit, Energie und Infrastruktur zu investieren. Der Städtetagspräsident wies darauf hin, dass die Kommunen in diesen Bereichen eine Schlüsselrolle spielen: „Der Bund hat praktisch keine Schulen oder Krankenhäuser, die Kommunen schon. Die Energiewende wird vor Ort umgesetzt. Und rund 80 Prozent der Straßen in Deutschland sind kommunale Straßen. Da ergibt es sich fast von selbst, dass ein erheblicher Teil des Sondervermögens auch vor Ort eingesetzt werden muss.“
Doch das Sondervermögen allein reicht nicht aus, um die Kommunen wieder handlungsfähig zu machen. Lewe zufolge bedarf es dringend weiterer Reformen und spürbarer Entlastungen. Die Kommunen tragen etwa ein Viertel der staatlichen Ausgaben, haben jedoch nur ein Siebtel der Steuereinnahmen. „Wir warnen davor, Steuersenkungen auf Kosten der kommunalen Kassen zu verabreden. Schon jetzt klaffen in den Haushalten der Städte große Löcher, und es muss an vielen Ecken und Enden gespart werden. Das spüren die Menschen.“
Rekorddefizit in Milliardenhöhe
Aufgrund dieser finanziellen Engpässe sehen sich die Städte und Kommunen mit einem Rekorddefizit in Milliardenhöhe konfrontiert. „Deshalb dürfen keine steuerpolitischen Maßnahmen von den Koalitionären verabredet werden, die zu Einnahmeausfällen bei den Kommunen führen. Ganz im Gegenteil: Für konkrete Politik für die Menschen brauchen wir einen höheren Steueranteil für die Städte“, forderte der Verbandschef.
Neben finanziellen Entlastungen verlangt der Deutsche Städtetag auch eine Vereinfachung der administrativen Verfahren. „Viele Vorgaben von Bund und Ländern gehören auf den Prüfstand“, so Lewe. Der Bürokratieabbau sei notwendig, um den Kommunen mehr Freiraum für die wichtigen Aufgaben zu geben. Die Verteilung des Sondervermögens stelle bereits eine erste Bewährungsprobe dar. Statt komplizierter Förderprogramme sollten die Kommunen feste Budgets erhalten, um flexibel auf lokale Bedürfnisse reagieren zu können.
Vereinfachte Vorschriften
Katja Dörner, Vizepräsidentin des Deutschen Städtetages und Bonner Oberbürgermeisterin, hob hervor, dass eine Vereinfachung auch im Bereich der Bauvorschriften notwendig sei. Sie verwies auf die Novelle des Baugesetzbuches, die in der vergangenen Legislaturperiode nicht mehr abgeschlossen worden sei. Diese hätte es den Städten ermöglicht, ohne komplizierte Planungsverfahren zu bauen und somit Infrastrukturprojekte schneller umzusetzen.
Ein weiteres wichtiges Thema bei der Diskussion um schnellere Verfahren ist der Naturschutz. Laut Dörner sind Klimaschutz, Klimaanpassung und der Erhalt der Biodiversität zentrale Zukunftsaufgaben. Der Deutsche Städtetag wolle zeigen, dass es möglich ist, Infrastrukturprojekte und Naturschutz miteinander zu vereinbaren. So könnten beispielsweise Kompensationsflächen für Umweltschäden schneller bereitgestellt werden, wenn Bauträger auf Flächenanbieter zurückgreifen, die ökologische Flächen bevorraten. Dörner zufolge sollte der Bund ein Vorkaufsrecht für diese Anbieter auf geeignete Flächen schaffen, um eine zügige Kompensation zu gewährleisten. Zudem sollte bei Sanierungen oder Neubauten bestehender Infrastrukturen wie Brücken oder Straßen auf eine erneute natur- und artenschutzrechtliche Prüfung verzichtet werden, wenn dies keine wesentlichen Auswirkungen auf die Umwelt hat.
Nach den Worten der Vizepräsidentin müsse auch die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse vorangetrieben werden. Nur so könne der bürokratische Aufwand minimiert und die Umsetzung von Projekten beschleunigt werden. „Alles, was das Potenzial hat, Infrastrukturprojekte zu beschleunigen, sollten wir uns genau ansehen. Da sind für uns definitiv auch Bund und Länder in der Pflicht. Sie müssen für durchgängig digitale Prozesse und praxisfreundliche Gesetze sorgen“, führte Dörner abschließend aus.
DK
Dieser Artikel hat Ihnen weitergeholfen?
Bedenken Sie nur, welche Informationsfülle ein Abo der Bayerischen GemeindeZeitung Ihnen liefern würde!
Hier geht’s zum Abo!