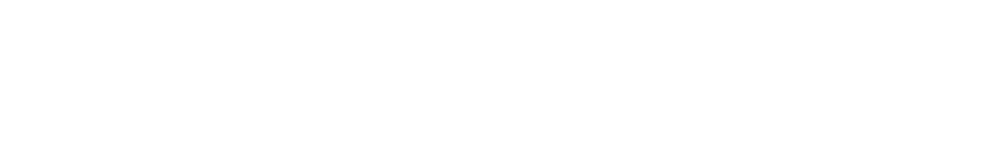| (GZ-4-2025 - 13. Februar) |
 |
► Bayerischer Städtetag: |
Transformation braucht Verlässlichkeit |
„Die großen Herausforderungen der Zeit gelingen nur mit den Städten und Gemeinden“, machte der Vorsitzende des Bayerischen Städtetags, Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr, in München vor Pressevertretern deutlich. Um tragfähige Lösungen zu finden, brauche es eine Veränderung des Politikstils, eine Priorisierung der Inhalte und eine Fokussierung auf wichtige Ziele, betonte der Verbandschef mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl.
Pannermayr forderte bei Gesetzgebungsverfahren die frühzeitige Einbindung der Kommunen: „Der Blick aus der kommunalen Praxis schärft das Bewusstsein für Regelungen, die sich dann auch realisieren lassen. Leider ist in den letzten Jahren die Partnerschaft oft vernachlässigt worden. Gerade, wenn Mut oder Gestaltungswille gefordert werden, müssen Bundestag und Bundesregierung die Städte und Gemeinden einbeziehen. Denn für die Umsetzung der Beschlüsse brauchen die Kommunen praktikable Regelungen und die notwendige Finanzausstattung.“
Stagnierende Steuereinnahmen
„Die kommunalen Steuereinnahmen stagnieren, während die Ausgaben massiv steigen“, erläuterte der Vorsitzende. Das Defizit der bayerischen Kommunen sei dramatisch gestiegen und liege in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 bei einem Rekord-Minus von 6 Milliarden Euro. Die Ursachen lägen in der Dynamik beim Anstieg von Sozialausgaben und Personalausgaben. Da die Wirtschaftskonjunktur unverändert schwach sei, stiegen die Risiken für Steuerrückgänge. Viele Städte und Gemeinden liefen Gefahr, keine genehmigungsfähigen Haushalte mehr aufstellen zu können. Dies bekämen Bürgerschaft und regionale Wirtschaft zu spüren. „Der Bedarf an Investitionen etwa bei Straßen und Wegen, Schulen und Kindergärten, Krankenhäusern und Pflegeheimen ist enorm. Dringende Investitionen in die Infrastruktur müssen zurückgestellt werden oder kommen generell auf den Prüfstand. Kommunen haben einen Anspruch auf eine aufgabengerechte Finanzierung. Wenn Bund und Freistaat den Kommunen zusätzliche Aufgaben übertragen, müssen diese auch auskömmlich finanziert werden“, forderte Pannermayr.
Resolution des Vorstands
Laut einer Resolution des Vorstands des Bayerischen Städtetags werden deshalb vom neuen Bundestag und der neuen Bundesregierung folgende Maßnahmen erwartet:
- Keine Aufgabenübertragungen und Schaffung von Rechtsansprüchen mehr, die für die kommunale Ebene nicht ausfinanziert sind. Als aktuelles Beispiel kann auf die nicht auskömmliche Betriebskostenförderung nach dem Ganztagsförderungsgesetz und dem Ganztagsfinanzierungsgesetz hingewiesen werden.
- Aufgabenspezifische Bundeserstattungen müssen dynamisiert werden, damit die Entlastungswirkung auf kommunaler Ebene nicht sukzessive durch Kostensteigerungen aufgezehrt wird. Das gilt beispielsweise für das seit 2018 greifende 5 Milliarden-Entlastungspaket des Bundes.
- Die hohe Dynamik bei den Sozialausgaben muss gestoppt werden. Leistungen und Standards müssen konsequent hinterfragt und auf den Prüfstand gestellt werden. Präventive Maßnahmen zur Vermeidung der Inanspruchnahme von Sozialleistungen sowie zur (Re-)Integration in den Arbeitsmarkt sind zu fördern. Die Mehrbelastungen durch den Transfer von geflüchteten Menschen aus der Ukraine in den Leistungsbereich der Sozialgesetzbücher II und XII müssen vollständig finanziert werden.
- Der Bund muss seiner Pflicht nachkommen, die Betriebskosten für Krankenhäuser sicherzustellen. Neben Soforthilfen muss eine Krankenhausreform des Bundes die strukturelle Unterfinanzierung beenden und die Finanzierung auf eine sichere Basis stellen.
- Die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden müssen gestärkt werden. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer. Die wichtigste Steuereinnahmequelle der Städte und Gemeinden darf nicht in Frage gestellt oder beschränkt werden. Die Absenkung der Gewerbesteuerumlage ist ein wirksames Instrument, um das Netto-Aufkommen bei den Städten und Gemeinden zu verbessern.
- Es braucht eine neue Finanzverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Um die kommunale Finanzausstattung dauerhaft zu stärken, ist ein höherer Anteil an den Gemeinschaftssteuereinnahmen ein guter Ansatz, etwa durch eine dauerhafte Anhebung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer.
- Neue Steuerentlastungsmaßnahmen dürfen nicht zu Lasten der kommunalen Ebene gehen. Gerade in der aktuellen Phase müssen Maßnahmen zur weiteren Reduzierung der Steuerlast einen Ausgleichsmechanismus für die Mindereinnahmen der Städte und Gemeinden enthalten. Dies muss vor allem beim angekündigten Steuerentlastungsprogramm gelten, das noch im Jahr 2025 auf den Weg gebracht werden soll.
- Beim Vollzug von Förderprogrammen ist weniger Komplexität, mehr Flexibilität und vor allem mehr Vertrauen gegenüber den Kommunen angebracht. Verhandlungen zwischen Bund und Ländern zur Ausgestaltung von Förderprogrammen sind schneller zum Abschluss zu bringen. Dabei müssen die Kommunen rechtzeitig vorher eingebunden und besser über den Stand der Verhandlungen informiert werden, damit sie ihre Planungen frühzeitig darauf ausrichten können.
Daueraufgabe Integration
Seit Jahren fordert die Daueraufgabe Integration Städte und Gemeinden. Wie Pannermayr ausführte, dürften Kommunen in ihrer Schlüsselrolle jedoch nicht überfordert werden. Denn scheitere Integration vor Ort, führe dies zu Spannungen mit populistischen Parolen.
Der Bund muss nach Auffassung des Deutschen Städtetags Zugangskontrollen und konsequente Aufenthaltsbeendigungen gewährleisten, illegale Migration eindämmen und sich auf europäischer Ebene für eine gerechtere Verteilung der Geflüchteten einsetzen. Die Voraussetzungen für den Familiennachzug seien anzupassen. Erteilungsvoraussetzungen für einen Aufenthaltstitel seien stark aufgeweicht worden, so dass etwa das Kriterium Verfügbarkeit von Wohnraum keine Rolle mehr spiele. Es gelte, strengere, an die örtlichen Realitäten angepasste Regelungen zu erlassen. Zudem müsse der Bund finanzielle Rahmenbedingungen schaffen, um Integrationsmaßnahmen vor Ort dauerhaft finanzieren zu können. Auch habe er dafür Sorge zu tragen, dass die Fachkräftezuwanderung erleichtert wird.
Gravierende Folgen durch demografischen Wandel
Der demografische Wandel hat Pannermayr zufolge gravierende Folgen für Städte und Gemeinden, sei es in Geburtsstationen und Krankenhäusern, Kindergärten und Pflegeheimen, Schulen und Seniorenheimen. Der demografische Wandel verschärft den Personalmangel in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes. Die Kommunen erleben Wachstumsdruck in Ballungsräumen oder rückläufige Bevölkerungsentwicklungen in strukturschwachen Regionen. Um diese „ungleichen und ungleichzeitigen Entwicklungen“ zu bewältigen, brauche es auch hier starke Städte und Gemeinden.
„Spätestens beim nächsten Hochwasser, bei Hitzerekorden, Waldbränden oder Wassermangel wird uns erneut drastisch vor Augen geführt, dass Klimaschutz und Klimaanpassung nicht vernachlässigt werden dürfen, fuhr der Städtetagschef fort: „Städte und Gemeinden leisten ihren Beitrag, aber sie müssen es sich auch leisten können. Es gilt, mit knappen Mitteln dort zu handeln, wo die Hebelwirkung für Klimaschutz und Klimaanpassung am größten ist. Die Aufgaben der Kommunen lassen sich nur erfüllen, wenn es klare Verantwortlichkeiten und Finanzierungswege gibt. Der Bund muss für eine nachhaltige Finanzierung von Maßnahmen bei Klimaschutz und Klimaanpassung sorgen. Wir brauchen keine neuen Pläne, sondern Geld für die Umsetzung.“
Zukunftsinvestitionen
Die bereits laufenden Transformationsprozesse bei Energiewende und Mobilitätswende seien fortzuführen. Transformation brauche Verlässlichkeit. Dies gelte etwa für Zukunftsinvestitionen in Geothermie oder eine Stärkung des Eigenkapitals für Investitionen von Stadtwerken in Energie- und Wärmewende. Nach Berechnungen der Wirtschaft beläuft sich das Investitionsvolumen für die Energiewende deutschlandweit bis 2030 auf 720 Milliarden Euro.
Städte und Gemeinden stellen eine verlässliche Verwaltung sicher und wollen Vorgänge mit neuen Technologien beschleunigen. Dafür brauchen sie stabile Rahmenbedingungen, wie der Vorsitzende erläuterte: „Der Bund muss die kommunale Perspektive berücksichtigen und Kommunen aller Größen im Blick haben. Neue digitale Verfahren können nur dann verlässlich laufen, wenn der Sachverstand aus der kommunalen Praxis frühzeitig eingebunden wird. Neue Gesetze müssen sich an den technisch möglichen digitalen Prozessen orientieren. Die Digitalisierung der Verwaltung muss stärker vereinheitlicht werden. Bund und Freistaat müssen ihre zentralen Angebote ausbauen, etwa für einheitliche Standards beim Datenaustausch und bei Schnittstellen.“
Vereinfachte digitale Verfahren und der Abbau von Bürokratie könnten nur gelingen, wenn die Belange von Städten und Gemeinden frühzeitig mitgedacht werden. Leider habe sich Bürokratie zunehmend zum Hemmschuh entwickelt. Die Gesellschaft müsse den Mut haben, weniger auf Einzelfallgerechtigkeit bis ins letzte Detail zu pochen. Nötig sei mehr Vertrauen statt Kontrolle. Pannermayrs Fazit: „Insgesamt haben wir kein Erkenntnisproblem, aber ein Handlungsproblem.“ Aus der „Mitte des Systems“ sei jedoch ein Neustart möglich, gab sich der Verbandschef zuversichtlich.
DK
Dieser Artikel hat Ihnen weitergeholfen?
Bedenken Sie nur, welche Informationsfülle ein Abo der Bayerischen GemeindeZeitung Ihnen liefern würde!
Hier geht’s zum Abo!