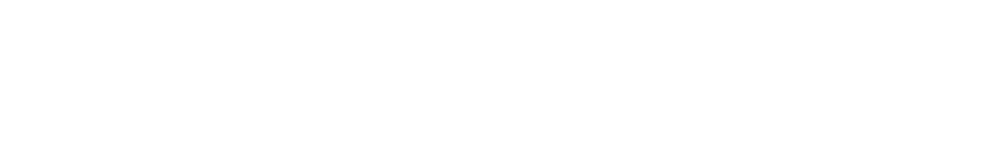| (GZ-3-2025 - 30. Januar) |
 |
► DStGB-Positionspapier: |
Regional- und Strukturförderung für starke Kommunen |
Mehr denn je sind Städte und Gemeinden in Folge von Transformationsprozessen durch Klimaschutz und Digitalisierung sowie des Demografischen Wandels gefordert, Zukunftsinvestitionen zu tätigen, um eine hohe Lebensqualität für die Menschen zu sichern und die Standortqualität für die Wirtschaft zu steigern. Angesichts der Herausforderungen bedarf es vor allem handlungsfähiger Kommunen und passgenauer Förderinstrumente. Das neue Positionspapier „Eine zukunftsgerichtete Regional- und Strukturförderung für starke Städte und Gemeinden“ fasst die maßgeblichen Forderungen des Deutschen Städte- und Gemeindebundes zur Regional- und Strukturpolitik zusammen und adressiert dabei die Akteure auf Ebene der EU, des Bundes und der Länder.
„Ziel muss sein, über eine Stärkung der Regionen eine Entlastung der Ballungsräume, etwa mit Blick auf den Wohnungsmarkt oder die Verkehrssituation herbeizuführen. Deutschlands Zukunft ist entscheidend an ein partnerschaftliches Zusammenwirken von Stadt und Land geknüpft. Die Bündelung der Programme verschiedener Bundesressorts im Gesamtdeutschen Fördersystem für strukturschwache Regionen bildete einen richtigen Ansatz“, urteilt der DStGB. Auf europäischer Ebene gelte es, für die Förderperiode ab 2028 jetzt entscheidende Weichen zu stellen, damit die Regional- und Strukturförderung sowie ländliche Räume ausreichend Berücksichtigung finden. Wichtig werde es auch in den kommenden Jahren sein, dass ausreichend Investitionsmittel für die Kommunen zur Verfügung stehen.
Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur
Eine Erfolgsstory sei die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW). Bereits seit 1969 fördere sie eine ausgewogene regionale Entwicklung in Deutschland. Dies betreffe Investitionen in gewerbliche sowie kommunale und wirtschaftsnahe Infrastruktur sowie Maßnahmen zur Vernetzung lokaler Akteure und Maßnahmen mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Die Förderung löse dabei in den Regionen erhebliche Hebeleffekte durch private Investitionen aus und schaffe bzw. sichere wichtige Arbeitsplätze.
Zusätzliche Förderbedarfe
Angesichts der umfangreichen Transformationsaufgaben ergäben sich zusätzliche Förderbedarfe. Die Neuausrichtung und Erweiterung der GRW hin zur klimaneutralen Wirtschaft sowie neue Fördermöglichkeiten wie Aspekte der Daseinsvorsorge berücksichtigten dies. „Eine erweiterte GRW bedarf nun auch zusätzlicher Mittel, damit alle Förderzwecke erreicht werden können. Neben einer wachsenden Finanzausstattung muss eine überjährige Verwendungsmöglichkeit der Mittel abgesichert werden“, betont der DStGB.
Auch eine Nutzung des Instruments GRW zur Realisierung strategischer Großprojekte werde nicht ohne Auswirkungen auf andere bedeutende Entwicklungsvorhaben in den Kommunen bleiben. Als eingespieltes System der Strukturförderung sei die GRW bereits heute überzeichnet, weshalb sich der Verband für eine dynamische Anhebung der GRW-Mittel in den kommenden Jahren einsetzt.
Dorfentwicklungskonzepte
Mit Blick auf das zentrale nationale Förderinstrument für die ländliche Entwicklung, die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK), wird dar-
auf verwiesen, dass in den vergangenen Jahren in zahlreichen Kommunen gezielt Dorfentwicklungskonzepte erstellt worden seien, deren konkrete Umsetzung nun von der Verfügbarkeit an GAK-Mitteln abhängt. Auch Mittel aus dem europäischen ELER seien oftmals an eine GAK-Förderung gebunden, weshalb Kürzungen im Bundeshaushalt bei der GAK fatal wären.
Verlässliche Perspektive
Vielmehr bedürfe es einer Anhebung der Mittel und vor allem einer verlässlichen Perspektive, damit Maßnahmen für attraktive und lebendige Ortskerne ebenso wie Investitionen für eine bessere Infrastruktur und Grundversorgung auf dem Land oder die Stärkung des Tourismus umgesetzt werden können. „Der im Jahr 2024 abgeschaffte Sonderrahmenplan bei der GAK stellte sicher, dass Mittel für die ländliche Entwicklung im Rahmen der GAK nicht durch andere Förderzwecke, insbesondere die Agrarförderung und die Forstwirtschaft entzogen werden. Bund und Länder sind aufgefordert, die GAK-Mittel für die ländliche Entwicklung langfristig abzusichern“, heißt es in dem Papier.
Finanzierungsperspektiven
Im Sinne einer Politik zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts der EU und einer besonderen Aufmerksamkeit auf ländliche Gebiete sei darüber hinaus „eine angemessene und wachsende Mittelausstattung der zweiten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik“ (GAP) zwingend erforderlich. Angezeigt sei auch eine Dynamisierung der Mittel, um den ländlich geprägten Kommunen und Akteuren vor Ort eine sichere Finanzierungsperspektive zu bieten.
Insbesondere im Bereich der etwa 370 LEADER-Regionen in Deutschland hätten sich in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreiche Strukturen der Regionalförderung und -entwicklung gebildet. Diese müssten in der Förderperiode ab 2028 erhalten und mittels des ELER mit Leben gefüllt werden. Eine Nationalisierung der Regionalentwicklung erachtet der DStGB dabei als falschen Weg. Stattdessen sollten eine Anwendung des erfolgreichen LEADER-Ansatzes auf den EFRE und den ESF ab 2028 geprüft werden. Dies betreffe auch die Nutzung von Regionalbudgets analog der GAK, „denn somit können unbürokratisch Mittel für passgenaue Projekte in die Regionen fließen“.
Die Hauptkritik an den EU-Fonds betrifft laut DStGB häufig die komplexe Bürokratie, von der Antragstellung bis zu Dokumentationspflichten. „Dies führt aufgrund fehlender Verwaltungskraft in den Kommunen nicht selten zur Nicht-Beantragung oder Aufgabe von Projekten und nicht zuletzt für Unverständnis bei den politischen Verantwortlichen und in der Bevölkerung. Es braucht daher einen Paradigmenwechsel hin zu einer Vereinfachung und Digitalisierung von Antragsverfahren sowie eine Angleichung bei der Abwicklung unterschiedlicher Fonds.“
Regionale Kompetenzzentren
Kurze Projektskizzen und eine verbesserte Beratung, etwa auf Landesebene oder durch regionale Kompetenzzentren, könnten den Zugang zu Fördermitteln erleichtern. Verwaltungs-, Kontroll- und Dokumentationsverfahren sollten auf das Notwendige beschränkt werden. Zudem sollten kommunale und professionell arbeitende Projektträger ebenso als vertrauenswürdig gelten wie regionale Gremien und Mandatsträger. Bei unvorhersehbaren Verzögerungen sei es ratsam, Fristen einfach zu verlängern.
Kofinanzierungssätze
Zu häufig sind finanzschwache Kommunen bislang nicht in der Lage, die notwendigen Eigenanteile aufzubringen. Daher müssen nach Auffassung des DStGB die Kofinanzierungssätze für ländliche und strukturschwache Regionen attraktiv und realisierbar sein und zusätzliche Verwaltungskosten berücksichtigen. Bund und Länder sollten niedrige Fördersätze gezielt aufstocken, um Struktureffekte dort auslösen zu können, wo sie benötigt werden. Weitere Erleichterungen könnten durch die Berücksichtigung sonstiger Projektkosten und das Prinzip einer einzigen Prüfung erfolgen. Auch könnte die Einführung von Bagatellgrenzen für geringfügige Verstöße die Bereitschaft steigern, an Förderprogrammen zu partizipieren.
DK
Dieser Artikel hat Ihnen weitergeholfen?
Bedenken Sie nur, welche Informationsfülle ein Abo der Bayerischen GemeindeZeitung Ihnen liefern würde!
Hier geht’s zum Abo!