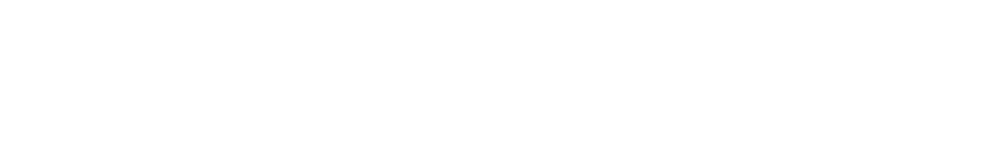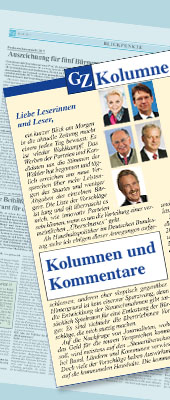| (GZ-4-2025 - 13. Februar) |
 |
► Genossenschaftsbanken leisten europäischer Einlagensicherung Vorschub: |
Kratzer im Lack |
|
Ein Kommentar von Dr. Jürgen Gros Lange Zeit galten die Volks- und Raiffeisenbanken als der Hort der Stabilität. Viele Krisenzeiten haben sie in den letzten 150 Jahren überstanden, und auch die Finanzkrisen der letzten zwanzig Jahre konnten ihnen wenig anhaben. Sie mussten nie vom Staat gerettet werden, brauchten keine Steuergelder, um zu überleben und gelten als krisenrobust.
Über zehn Jahre konnten sie die politische Abwehrschlacht erfolgreich führen. Zuletzt im Frühjahr 2024, als im ECON, dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments, das Thema kurzfristig vor Ablauf der Legislaturperiode nochmals auf die Tagesordnung rutschte. Genossenschaftsbanken und Sparkassen durften es sich als Erfolg zurechnen, dass es letztlich nicht zu einem Mandat für Trilog-Verhandlungen zwischen Europäischem Parlament, Kommission und Rat zur Realisierung von EDIS kam. Europäische EinlagensicherungAufgeschoben ist allerdings nicht aufgehoben. In Brüssel allemal nicht. Es darf als sicher gelten, dass das gilt, was seit 2015 immer galt. Die europäische Einlagensicherung wird in der laufenden Legislaturperiode (irgendwann) wieder auf der Agenda der EU stehen. Der darauffolgenden Debatte werden die hiesigen Genossenschaftsbanken dieses Mal womöglich geschwächt gegenüberstehen. Denn nicht nur in Kreisen deutscher Bankenaufseher, sondern auch in Europa nimmt man ihre diversen Brennpunkte wahr. Die Kratzer im Lack sind nicht zu übersehen. Deutschlandweit sind mehrere Kreditgenossenschaften ins Trudeln geraten und benötigen Hilfsleistungen aus der verbundeigenen Institutssicherung. Beobachter schätzen, dass allein die öffentlich bekannten Fälle in Düsseldorf-Neuss, Bad Salzungen-Schmalkalden, Dortmund-Nordwest den genossenschaftlichen Rettungsfonds einen mittelprächtigen dreistelligen Millionenbetrag kosten. Darüber hinaus ist ungewiss, was für die bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken aus der Baywa-Misere folgt.Gehäufte Krisenfälle Was unterm Strich bleibt, ist das merklich geschwächte Kernargument der Genossen in ihrem Kampf gegen das europäische Einlagensicherungssystem. Bislang konnte man schließlich immer auf ein gut funktionierendes Frühwarnsystem und solide Präventionsarbeit verweisen. Beides dient dem Schutz der Kundengelder und ist quasi die spezifische – bislang erfolgreiche – Form der genossenschaftlichen Einlagensicherung. Beides war über Jahrzehnte, zumindest in der öffentlichen und politischen Wahrnehmung, Legende. Angesichts gehäufter Krisenfälle verblasst freilich der einstige Mythos. Damit höhlt sich – jedenfalls in den Augen derer, die für eine gemeinsame Einlagensicherung aller Banken in den Euro-Staaten werben – zunehmend das Argument aus, nach dem die Kreditgenossenschaften durch eine konservative Geschäfts- und Präventionspolitik gar nicht erst in die Situation kämen, für ihre Kunden im Falle des Krisenfalles eine Einlagenentschädigung zu benötigen. Schon länger fragt sich selbst in den eigenen Reihen mancher, inwieweit die in der genossenschaftlichen Institutssicherung angesammelten Mittel künftig ausreichen, potenzielle Pannen auch in größeren (und immer größer werdenden) Kreditgenossenschaften ohne fremde Hilfe abzuschirmen. Zweierlei jedenfalls zeichnet sich im und für das genossenschaftliche Lager ab – zu welchem im Übrigen auch die Sparda- und PSD-Banken zählen. Zum einen wird der Unmut der Geschäftsleiter größer, die einen soliden Kurs steuern, zugleich aber in der Solidarhaftung für die Kollegen im Verbund stehen, die einen heißen Reifen fahren, indem sie hohe Geschäftsrisiken eingehen. Zum anderen leisten Letztere jenen Verfechtern einer europäischen Einlagensicherung Vorschub, die dem Sonderstatus der Institutssicherungssystemen der Verbundgruppen schon immer skeptisch gegenüberstanden. Die Zeiten für die Kreditgenossen werden härter. Auch politisch. Über unseren Autor Der an der Ludwig-Maximilians-Universität in München promovierte Politikwissenschaftler Jürgen Gros (*1969) war zwei Jahrzehnte im Management verschiedener bayerischer Verbände tätig, zuletzt als Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern. Schwerpunktmäßig beschäftigt er sich mit finanzwirtschaftlichen und mittelstandspolitischen Themen. |
|
Dieser Artikel hat Ihnen weitergeholfen? |