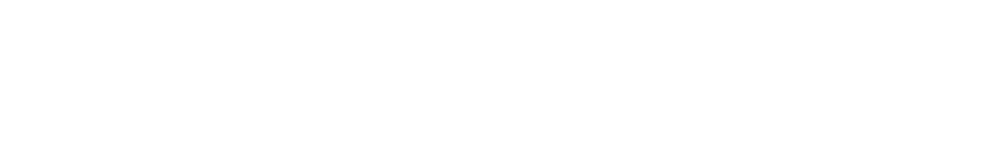| (GZ-11-2025 - 30. Mai) |
 |
► Wie Qair den Schulterschluss mit Kommunen in Bayern sucht |
Energiewende ist Teamsache |
Wind im Wald, Sonnenstrom vom Acker und kommunale Beteiligungsmodelle – Heike von der Heyden von der Qair Group spricht im Interview mit der Bayerischen GemeindeZeitung über Synergien, Stolpersteine und warum Projektentwicklung für Erneuerbare vor allem eines ist: ein Gemeinschaftsprojekt.

Heike von der Heyden. Bild: Qair
GZ: Frau von der Heyden, die Qair Group engagiert sich europaweit für die Energiewende. Wo sehen Sie aktuell die größten Potenziale für Wind- und Solarenergie in Bayern – speziell im ländlichen Raum?
Heike von der Heyden: Der ländliche Raum Bayerns bietet nach wie vor die größten Flächenreserven – und damit auch enormes Potenzial für den weiteren Ausbau von Wind- und Solarenergie. Bayern ist bereits heute führend bei der Photovoltaik: Über 26 Prozent der Bruttostromerzeugung stammen hier - Stand 2024 - aus Solarenergie. Diese Stärke lässt sich noch besser nutzen, wenn wir intelligenter kombinieren – zum Beispiel über Agri-PV, bei der Landwirtschaft und Stromerzeugung auf derselben Fläche möglich sind. Dank hoher Sonnenstunden in Bayern ist das sehr attraktiv.
Beim Wind ist die Situation komplexer, da Bayern stark bewaldet ist. Aber auch hier gibt es Fortschritte – sowohl technisch als auch gesellschaftlich. Die Akzeptanz steigt, wenn man die Bevölkerung einbindet und mit den Gemeinden, Naturschutzverbänden und Förstern frühzeitig zusammenarbeitet Unser Windpark-Projekt bei Altötting zeigt, wie erfolgreiche Projekte im Schulterschluss gelingen. Ganz entscheidend ist auch der direkte Austausch mit Gemeinderäten und kommunalen Arbeitskreisen – denn dort sitzen Menschen mit einem tiefen Verständnis für ihre Region. Nur wenn man weiß, welche Bedarfe es lokal gibt – etwa zur Einbindung von Geothermie oder zur Speicherung von Solarstrom – kann man passgenaue Lösungen entwickeln.
GZ: Viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister berichten von langen Genehmigungsprozessen und Widerständen vor Ort. Was kann aus Ihrer Sicht getan werden, um Planungs- und Umsetzungszeiten zu verkürzen – ohne Akzeptanz zu verlieren?
von der Heyden: Es braucht ein kluges Zusammenspiel aus Kommunikation, Genehmigungsmanagement und Digitalisierung. Wir empfehlen, schon vor Beginn des eigentlichen Genehmigungsverfahrens Arbeitskreise mit Gemeinderäten, Planungsbehörden und auch externen Fachleuten zu bilden. Denn jeder Standort bringt eigene Herausforderungen mit sich – sei es eine seltene Baumart, ein denkmalgeschütztes Gebäude oder besondere Artenvorkommen. Je früher wir das wissen, desto gezielter können wir planen.
Wichtig ist auch, parallel zu denken: Wir gehen früh in den Dialog mit den Bürgern, aber auch in die Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden. Förster und Naturschutzverbände sind für uns wertvolle Partner – gerade bei Projekten im Wald. Ergänzend braucht es mehr Personal in den Behörden und digitale Schnittstellen wie Projektplattformen, damit der Informationsfluss effizienter läuft. Momentan gibt es oft zu viele Anträge für zu wenig Fachpersonal in den Behörden, hier können standardisierte Verfahren entlasten.
GZ: Wie gelingt es Kommunen, bei Energieprojekten nicht nur Standort, sondern aktiver Mitgestalter und auch wirtschaftlicher Profiteur zu sein? Haben Sie hierfür ein konkretes Beispiel aus Ihrer Arbeit?
von der Heyden: Unsere Grundhaltung ist: Kommunen sind keine Statisten, sondern aktive Partner - mit Einfluss auf Planung, Gestaltung und wirtschaftliche Teilhabe. In einem konkreten Projekt haben wir zum Beispiel gemeinsam mit einer Kommune festgelegt, wie Ausgleichsmaßnahmen für den Wald gestaltet werden – so, dass auch andere Projekte im Ort davon profitieren. Solche Synergien entstehen nur im offenen Dialog.
Finanziell profitieren Kommunen über Pachtzahlungen, Gewerbesteuereinnahmen oder – noch stärker – durch direkte Beteiligung. In einigen Fällen sitzt die Gemeinde selbst oder z.B. über ihre Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit im Aufsichtsrat des Projekts – das sichert Mitsprache und Einnahmen zugleich.
Besonders wirkungsvoll ist zudem die Kommunalbeteiligung bei Windenergieprojekten: Gemeinden im Umkreis von 2,5 Kilometern erhalten 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde – eine Einnahme, die nicht der Kreisumlage unterliegt und vor Ort verbleibt. Und nicht zu vergessen: Erneuerbare schaffen Standortvorteile – gerade für Unternehmen, die klimaneutral wirtschaften wollen.
GZ: Bürgerbeteiligung wird zunehmend zum Erfolgsfaktor. Wie gestalten Sie Beteiligungsmodelle konkret, sodass sie nicht nur symbolisch, sondern auch wirtschaftlich attraktiv für Bürgerinnen und Bürger sind?
von der Heyden: Wir setzen auf zweigleisige Modelle: Zum einen kooperieren wir mit lokalen Bürgerenergiegenossenschaften, die unsere Projekte prüfen und begleiten. Zum anderen bieten wir Crowdinvesting an – also Nachrangdarlehen, bei denen Bürgerinnen und Bürger schon ab 250 Euro investieren können, zu festen und/oder erfolgsabhängigen Zinsen. Diese Modelle sind bewusst so gestaltet, dass sie auch für Haushalte mit kleinerem Budget attraktiv sind.
Einige Gemeinden gehen sogar noch weiter und beteiligen sich selbst an den Energiegenossenschaften, die die Projekte initiieren. Das ist ein starkes Zeichen, denn es verbindet politische Rückendeckung mit wirtschaftlichem Engagement. Entscheidend ist, dass die Beteiligung keine Hürde sein darf – weder inhaltlich noch finanziell.
GZ: Gibt es in Bayern regulatorische oder strukturelle Besonderheiten, die Ihnen die Arbeit erschweren – oder erleichtern? Was würden Sie sich von Seiten der Landespolitik konkret wünschen?
von der Heyden: Bayern ist ambitioniert, doch auf dem Weg zur Umsetzung sehen wir noch Luft nach oben. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass Energiepolitik ganzheitlich gedacht wird –Wir müssen weg vom Entweder-oder: Solar, Wind, Netze und Speicher gehören gemeinsam gedacht, als Teil eines Systems – sonst verlieren wir Zeit und Effizienz. Auch Herkunftsnachweise für Erneuerbare sind für viele Unternehmen inzwischen entscheidend – sie wollen lokal klimaneutral werden. Dafür braucht es eine direkte Versorgung vor Ort.
Was wir brauchen, ist Planungssicherheit – etwa beim Strommarktdesign nach 2027 oder beim EEG. Momentan fehlt es hier an klaren politischen Signalen. Ein weiteres Thema ist das Gesetz zur verpflichtenden Bürgerbeteiligung: Je komplexer die Regeln, desto größer die Hürden – und desto weniger bleibt am Ende für die Menschen vor Ort übrig. Statt starrer Vorgaben wünschen wir uns mehr Handlungsspielraum und Vertrauen in die kommunalen Akteure. Sie wissen meist am besten, was vor Ort gebraucht wird.
GZ: Zum Schluss: Was raten Sie einer Kommune, die 2025 erstmals aktiv in die Projektentwicklung von Erneuerbaren einsteigen will – wo sollte man anfangen, und welche Fehler sollte man vermeiden?
von der Heyden: Mein Rat: Nehmen Sie sich Zeit und gehen Sie strategisch vor. Starten Sie mit einer Potenzialanalyse, nutzen Sie Fördermittel des Bundes oder der Landesregierung, bilden Sie einen interdisziplinären Arbeitskreis aus Interessierten und Fachleuten, laden Sie erfahrene Projektierer zu Infoveranstaltungen oder Workshops ein – und besuchen Sie Gemeinden, die bereits erfolgreich unterwegs sind. So gewinnen Sie einen Überblick über Konzepte, Beteiligungsmodelle und auch typische Stolpersteine.
Vermeiden Sie es, sich zu schnell auf einen bestimmten Partner oder ein Konzept zu versteifen. Breite Information und Vergleich bringen Qualität. Gleichzeitig braucht es auf kommunaler Seite Menschen, die langfristig an dem Thema arbeiten – etwa in der Bauverwaltung oder der Wirtschaftsförderung.
Und nicht zuletzt: Vernetzen Sie sich! Auch unter den Projektierern findet zunehmend Austausch statt – etwa zur Nutzung gemeinsamer Studien wie z.B. zu Bodengutachten. Das kostet anfangs Zeit, spart aber später Geld und Nerven. Wenn Energiewende als gemeinschaftliche Aufgabe verstanden wird, kann sie auch verbinden – und genau das brauchen wir in Zeiten wie diesen. CH
Dieser Artikel hat Ihnen weitergeholfen?
Bedenken Sie nur, welche Informationsfülle ein Abo der Bayerischen GemeindeZeitung Ihnen liefern würde!
Hier geht’s zum Abo!