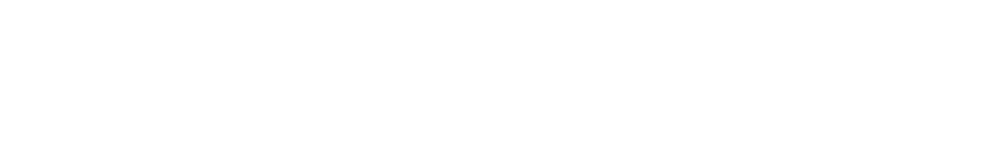| (GZ-17-2023 - 14. September) |
 |
► Aktualisierte BdSt-Broschüre „Kommunalkompass“: |
Tipps zum Sparen in der Kommune |
|
Die Politik ist dazu aufgerufen, die öffentlichen Haushalte nachhaltig zu sichern – nicht nur in Bund und Ländern, sondern auch bis hinein in die Kommunen. In diesem Sinne wurden in der aktualisierten BdSt-Broschüre „Kommunalkompass – Tipps zum Sparen in der Kommune“ Vorschläge, die sich bei der Haushaltskonsolidierung bewährt haben, grundlegend überarbeitet.
Kapitel 1: Innere Verwaltung |
Laut Rolf Baron von Hohenhau, Präsident des Bundes der Steuerzahler in Bayern, stammen die Vorschläge aus der langjährigen Analyse und Bewertung von Kommunalhaushalten durch die Landesverbände des BdSt. Ab sofort wird die Bayerische GemeindeZeitung in ihren Ausgaben mit dem Themenschwerpunkt „Finanzen“ über konkrete Konsolidierungstipps zu den Themen Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, Schule und Kultur, Kinder, Jugend und Sport, Soziales und Senioren, Planen, Bauen und Umwelt, Wirtschaftsförderung und Tourismus, sowie Allgemeine Finanzwirtschaft informieren.
Beim Thema Innere Verwaltung ist zunächst eine klare Aufgabenteilung zwischen Vertretung und Verwaltung ein wesentlicher Schlüsselfaktor für die Konsolidierung des kommunalen Haushalts: Während Kommunalpolitiker strategische Entscheidungen treffen und das „Was“ festlegen sollten, sollte der Verwaltung das „Wie“, d.h. die konkrete Ausführung, überlassen bleiben. Leider, so die Beobachtung der Experten, hindere das Einbringen persönlicher Expertise in Detailfragen durch Kommunalpolitiker häufig eher bei der effizienten Aufgabenerfüllung.
Daneben sollten Möglichkeiten zur Verkleinerung der Vertretungskörperschaften genutzt und die Zahl der ständigen Ausschüsse geringgehalten werden. Schließlich erzeuge jeder Ausschuss zusätzlichen Aufwand in der Verwaltung und erfordere weitere Abstimmungsprozesse. Zudem wird vorgeschlagen, in den Vorlagen die zuständigen Sachbearbeiter der Verwaltung zu benennen, die fachliche Rückfragen der Kommunalpolitiker unverzüglich beantworten können. Jede Beschlussvorlage sollte nicht nur Alternativen samt ihren finanziellen Auswirkungen enthalten, sondern darüber hinaus neben dem einmaligen Haushaltsaufwand immer auch Aussagen über die mittelfristigen Folgekosten und – soweit möglich – eine Wirtschaftlichkeitsberechnung.
Gutachteraufträge
Empfohlen wird, externe Gutachten zur Entscheidungsvorbereitung nur zu vergeben, wenn der politische Wille zur Umsetzung auch vorhanden ist, die notwendigen Finanzmittel tatsächlich zur Verfügung stehen und der Gutachterauftrag klar definiert ist. Gleiches sollte auch für interne Prüfaufträge an die Verwaltung gelten. Zudem wird darauf hingewiesen, die Kommunikation zwischen Verwaltung und Kommunalvertretern weitgehend zu digitalisieren.
„Kommunalpolitiker müssen für ihre besondere Tätigkeit eine angemessene Aufwandsentschädigung erhalten“, heißt es weiter. „Satzungen, die pauschalierte Regelungen vorsehen, erleichtern die Abwicklung und fördern die Transparenz. Da bei der Fraktionsfinanzierung häufig die Aufgaben der Selbstverwaltung mit der Parteipolitik verschwimmen, ist die Finanzausstattung der Fraktionen nach strengen Maßgaben zu begrenzen und es muss eine transparente Verwendungskontrolle durch die Rechnungsprüfungsämter geben.“
Als entscheidender Schlüssel für wirtschaftliches Verwaltungshandeln wird ein effizienter Aufbau und Ablauforganisation genannt. Hier gelte es, moderne Erkenntnisse aus der Organisationswissenschaft mit den besonderen Aufgabenstellungen der öffentlichen Verwaltung zu verbinden.
Personalausstattung
Gilt bei der Personalausstattung der Verwaltung das Motto: „Mehr Klasse als Masse“, sollte die Sachausstattung in erster Linie der Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter dienen, um die wertvollste Ressource, die menschliche Arbeitskraft, besonders effektiv einsetzen zu können. Allen Entscheidungsträgern müsse bewusst sein, dass die IT-Ausstattung keine einmalige Investition darstellt, sondern ein dauerhaft laufendes Projekt mit regelmäßigem Anpassungsbedarf. Pflege und Wartung der IT-Ausstattung seien Sache der Spezialisten. Verwaltungsmitarbeiter sollten sich auf ihre Aufgabenbereiche konzentrieren und nicht mit der Lösung von IT-Problemen befasst sein.
Zu den Aufgaben einer Kommune gehört es, das Gemeinschaftsleben und den Bürgersinn zu stärken. Dabei dürfe aber nicht vergessen werden, dass die Kommune selbst hier nur die Rahmenbedingungen schaffen kann. „Imagepflege darf kein Selbstzweck werden“, macht der BdSt deutlich.
Bürgerschaftliches Engagement und Gemeinschaftsleben innerhalb einer Kommune sollten durch die ehrenamtlichen Strukturen der Organisationen, Vereine und Verbände geprägt werden. Dies gelte auch für die Pflege internationaler Kontakte und Patenschaften. Durch die Übertragung von imagebildenden und repräsentativen Aufgaben auf ehrenamtliche Gremien könnten oft bessere Ergebnisse erzielt werden als durch hauptamtliches Verwaltungshandeln.
Zumeist als wenig erfolgreich erweise sich eine kostenträchtige Imagewerbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben und Wohnbevölkerung. Standortentscheidungen würden nach anderen Kriterien getroffen. Gepflegte öffentliche Einrichtungen und eine Außendarstellung unter Verwendung des traditionellen Wappens reichten zusammen mit regen ehrenamtlichen Aktivitäten für ein gutes Standortimage aus. Die professionelle Entwicklung eines „Corporate Designs“ mit neuen Wort-Bild-Marken durch Werbeagenturen sei dagegen weder sinnvoll noch notwendig.
„Mit seinen gesammelten Vorschlägen bringt der Bund der Steuerzahler das Problem auf den Punkt: Durch die Bundes- und Landesgesetzgeber werden den Kommunen immer mehr Pflichtaufgaben mit höheren Qualitätsstandards auferlegt, ohne für die notwendige Finanzierung zu sorgen. Darum fällt es Verantwortlichen schwer, selbst zwingend nötige Konsolidierungsmaßnahmen zu beschließen“, so Maria Ritch, Vizepräsidentin des Bundes der Steuerzahler in Bayern. Somit richte sich die Publikation in erster Linie an ehrenamtliche Kommunalpolitiker und Verwaltungen. Schließlich gälten die Kommunen als „Keimzelle unserer Demokratie“.
Kapitel 2: Sicherheit und Ordnung
Das Bedürfnis der Bürgerschaft nach einem erhöhten Sicherheitsgefühl, Ordnung und Sauberkeit in Städten steigt. Die Präsenz der Polizei im Straßenbild nimmt ab, weil sie sich auf Einsatzaufgaben konzentriert. Deshalb wird von Städten und Gemeinden immer häufiger gefordert, einen kommunalen Ordnungsdienst vorzuhalten, der über die Aufgaben der traditionellen Parkraumüberwachung hinausgeht.
Ein eigenständiger kommunaler Ordnungsdienst sollte nach Ansicht des Bundes der Steuerzahler nur vorgehalten werden, wenn dafür ein tatsächlich nicht abweisbarer Bedarf vorhanden ist. Die Erwartung, der kommunale Ordnungsdienst könne sich durch die Verhängung von Bußgeldern selbst finanzieren, bewahrheite sich in der Praxis nicht. Zumindest bei Vollkostenrechnung erfordere daher die Einrichtung eines kommunalen Ordnungsdienstes immer den Einsatz zusätzlicher Haushaltsmittel. Die Beschäftigung des Ordnungsdienstes sollte sich deshalb auf wirkliche Brennpunkte mit einer hohen Zahl von Ordnungswidrigkeiten konzentrieren.
Empfohlen wird, die Absicherung von (Groß)-Veranstaltungen an private Sicherheitsdienste zu vergeben, weil deren Einsatz günstiger als jener der eigenen Mitarbeiter ist. In benachbarten Städten und Gemeinden sollte der Ordnungsdienst interkommunal organisiert werden, um Verwaltungskosten einzusparen und Schwerpunkte bilden zu können.
Eine „Pflichtaufgabe nach Weisung“ der Städte und Gemeinden stellt die Organisation einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr dar. Die Vorgaben und Rahmenbedingungen werden durch Landesrecht festgelegt und unterscheiden sich je nach Bundesland im Detail. Dennoch gibt es Stellgrößen für die Kommunalpolitik, die den finanziellen Aufwand beeinflussen.
Freiwillige Feuerwehren
Laut BdSt sind Freiwillige Feuerwehren eine sehr wertvolle und kostengünstige Ressource, weil für die hauptamtliche Besetzung einer Funktionsstelle rund um die Uhr durchschnittlich fünf Vollzeitstellen benötigt werden. Wo immer möglich, sollte deshalb der Brandschutz über Freiwillige Feuerwehren sichergestellt werden. Das Ehrenamt findet aber dort seine Grenzen, wo die Häufigkeit der Alarmierung nicht mehr mit Berufs- und Privatleben zu vereinbaren ist oder zu bestimmten Tageszeiten nicht ausreichend einsatzbereite Kräfte zur Verfügung stehen.
Freiwillige Feuerwehren mit hauptamtlichen Kräften ermöglichen es, die Ehrenamtlichen von Kleineinsätzen zu entlasten und die Hilfsfrist zu verkürzen, wenn nur wenige Freiwillige schnell verfügbar sind. Auch in Städten mit einer Berufsfeuerwehr sollten die freiwilligen Einheiten eingebunden werden: Während diehauptamtlichen Kräfte den Grundschutz sicherstellen, können sie bei größeren Einsatzlagen verstärken und Sonderaufgaben übernehmen. Damit sinkt der Personalbedarf der Berufsfeuerwehr.
Für Sonderaufgaben, die eine spezielle Ausbildung und Ausstattung erfordern, aber nur selten benötigt werden, bietet sich eine interkommunale Aufgabenteilung an, die nicht nur Kosten spart, sondern auch die qualitative Aufgabenwahrnehmung verbessert.
Einsatzfahrzeuge sollten nur dort stationiert werden, wo die örtliche Feuerwehreinheit sie auch sicher besetzen kann. Ein Löschfahrzeug, das aus Personalmangel nicht ausrücken kann, ist für die Kommune wertlos. Daher kann eine Zusammenlegung von Standorten zur erheblichen Stärkung des Einsatzwertes beitragen. Traditionsreiche ehrenamtliche Strukturen können bestehen bleiben und sich einen gemeinsamen Einsatzstützpunkt teilen.
„Bei den Ausschreibungen ist es sehr wichtig, auf produkt- und herstellerneutrale Leistungsverzeichnisse zu achten“, heißt es weiter. Ausschreibungen, die auf ein „Wunschfahrzeug“ zugeschnitten sind, verhinderten den Wettbewerb und führten zu erheblichen Mehrkosten. Insbesondere Spezialfahrzeuge wie etwa Drehleitern, Kräne oder Wechsellader seien nicht nur in der Anschaffung teuer, sondern führten auch zu hohen Folgekosten, weshalb sie nach Möglichkeit interkommunal beschafft und unterhalten werden sollten.
Sehr stark unterscheidet sich zwischen den Bundesländern die Organisation des Rettungsdienstes. Wie der Bund der Steuerzahler ausführt, sei die Sicherstellung in allen Flächenländern jedoch den Kreisen und kreisfreien Städten als Pflichtaufgabe zugewiesen worden. Auslegungsfragen des EU-Wettbewerbsrechts führten aktuell zu Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen. Grundsätzlich solle der Regelrettungsdienst aber kostendeckend betrieben werden, d. h. alle Aufwendungen sollten sich durch Benutzungsgebühren oder -entgelte refinanzieren.
Rettungsdienst
Nach Auffassung des BdSt sollte der Rettungsdienst als kostenrechnende Einrichtung betrieben werden. Bei Feuerwehren, die in den Rettungsdienst eingebunden sind, sei die Kostenstelle Rettungsdienst sauber zu trennen, damit ein Nachweis des Kostendeckungsgrades möglich ist.
Es wird empfohlen, die Standorte der Rettungswachen und die Rettungsmittelvorhaltung in einem Bedarfsplan festzulegen, der mit den Kostenträgern (Krankenkassen) abzustimmen ist. Im Streitfall könnten Sachverständigenbüros zur Berechnung des notwendigen Bedarfs herangezogen werden.
Vor größeren Infrastruktur- und Fahrzeuginvestitionen sollte die Zustimmung der Kostenträger eingeholt werden, um die Abrechnungsfähigkeit sicherzustellen. Für die Bewältigung von größeren Notfallereignissen seien auch die Mittel des Katastrophenschutzes einzuplanen, die ebenfalls den Kreisen unterstehen. Den Regelrettungsdienst freiwillig verstärkende Initiativen („Helfer vor Ort“, „First Responder“) sollten ausschließlich ehrenamtlich betrieben und aus Spendenmitteln finanziert werden.
Kapitel 3: Schule und Kultur
Für die Städte und Gemeinden werden die Aufgaben als Schulträger zu einer immer größeren Herausforderung. Nicht nur die weiter zunehmende Digitalisierung von Unterricht und Verwaltung führt zu notwendigen Investitionen, sondern auch neue pädagogische Konzepte mit kleineren Lerngruppen (Kurssysteme, Binnendifferenzierung) erzeugen Anpassungsbedarf bei den Schulgebäuden. Hinzu kommen die Ganztagsbetreuung mit Mittagsverpflegung und Schulgebäude mit hohen Sanierungsrückständen. Die Summe der bestehenden Probleme ist in manchen Kommunen so groß, dass über eine grundlegende Neuplanung des Schulkonzepts nachgedacht werden muss.
Durchgängig zweizügig
Aus Sicht des Bundes der Steuerzahler ist insbesondere aus pädagogischen Gründen die romantische Vorstellung von wohnortnahen Klein- und Kleinstschulen abzulehnen. Für die Vorhaltung von Fachräumen und -sammlungen sowie für einen qualifizierten Fachunterricht mit entsprechender Vertretung im Krankheitsfall sollte eine Schule durchgängig mindestens zweizügig sein.
Feste Schuleinzugsbereiche erleichterten die Bedarfsplanung und seien die Voraussetzung für eine leistungsfähige Schülerbeförderung. Um gegenseitige Synergieeffekte zu nutzen, sollten Schülerbeförderung und öffentlicher Nahverkehr möglichst integriert werden. Eine flexible Anpassung der Stundenplanzeiten könne auch örtliche Verkehrsprobleme entzerren.
Gesamtkonzept erarbeiten
Vor energetischen Einzelmaßnahmen sollte laut BdSt ein Gesamtkonzept erarbeitet werden, das insbesondere auch eine digitale Regelung der Gebäudetechnik beinhaltet. Sinnvoll sei dies auch vor Nachbesserungen bei Brandschutzmaßnahmen.
Umfassende Digitalisierungskonzepte erforderten eine hohe Planungskompetenz, die in der Regel nur durch externe Berater sichergestellt werden kann. Dabei sei darauf zu achten, dass die Beratung produkt- und anbieterneutral erfolgt. Für einen hohen Grad der Digitalisierung sei ein entsprechender Administrationsaufwand unverzichtbar. „Dieser kann und sollte nicht durch die Lehrkräfte geleistet werden, weil sich diese auf den Unterricht konzentrieren müssen“, heißt es.
Bei Schulgebäuden mit hohem Sanierungsrückstand und keiner anforderungsgerechten Raumausstattung gelte es überdies zu prüfen, ob ein Neubau die wirtschaftlichere Alternative darstellt. Für die Finanzierung gebe es unterschiedliche Konsolidierungsvorschläge für den kommunalen Haushalt, die teilweise auch private Investoren mit einbeziehen. „Für die notwendigen Wirtschaftlichkeitsvergleiche sollte sich die Kommune anbieterneutral beraten lassen. Bei einem Schulneubau sollte auf eine möglichst multifunktionale Nutzung geachtet werden, um die Räume außerhalb des Unterrichts für Veranstaltungen, Volkshochschulen und andere Einrichtungen nutzen zu können.“
Kultur und Bildung
Ohne Frage haben Kommunen auch einen Kultur- und Bildungsauftrag. Gleichzeitig unterliegen diese sogenannten freiwilligen Leistungen einem permanenten Einsparungsdruck. Dieser Zwiespalt hat dazu geführt, dass viele Kommunen zwar zahlreiche Kultur und Bildungsmaßnahmen (mit) finanzieren, sich jede einzelne Einrichtung aber nicht ausreichend ausgestattet empfindet, um ihren Auftrag in der gewünschten Qualität erfüllen zu können. „Darum gilt hier das Motto: Weniger ist mehr! Die Kommunen sollten sich im Kultur- und Bildungsbereich auf wenige Maßnahmen konzentrieren, die dann aber auch eine besondere Strahlkraft erzielen“, betont der Bund der Steuerzahler.
Mehrspartentheater sind nach seinen Angaben sehr teuer, weil neben den künstlerischen Ensembles auch eine große Zahl von technischen, kaufmännischen und sonstigen Mitarbeitern mit hohen tariflichen Eingruppierungen zu finanzieren sind. Für benachbarte Kommunen böten sich Theaterverbünde an, die mit ihren Produktionen mehrere Bühnen bespielen. Ensembles, Werkstätten und Leitung könnten zusammengelegt werden. Durch die Übernahme von Inszenierungen anderer Häuser sei es möglich, das Repertoire kostengünstig zu erweitern.
Eine Verlängerung der Spielzeit (zum Beispiel als Sommertheater) ermögliche die Erhöhung der Besucherzahlen, heißt es weiter. In spielfreien Zeiten sollten die Bühnen und Häuser auch für andere kulturelle Zwecke zur Verfügung stehen. Museen und Galerien sollten nur dann in kommunaler Trägerschaft betrieben werden, wenn sie tatsächlich eine überregionale Bedeutung aufweisen. Für die Durchführung von Kulturveranstaltungen jeglicher Art sei es sinnvoll, nach Möglichkeit (dauerhafte) Sponsoren zu finden.
Stadtbibliotheken und Volkshochschulen
Die Kostenbelastung durch Museen und Galerien könne ebenso wie die von Stadtbibliotheken deutlich gesenkt werden, wenn die Öffnung auf Zeiten hoher Besucherzahlen konzentriert wird, weil das Aufsichts- und Kassenpersonal dann besser ausgelastet ist. Für besondere Besuchergruppen sei es ratsam, flexible Führungstermine zu vereinbaren.
Insbesondere für kommunale Archive, Musik und Volkshochschulen biete sich „eine gemeinsame Trägerschaft durch benachbarte Gemeinden“ an. Beim Betrieb kommunaler Musikschulen sei zu beachten, dass es freiberuflich tätige Musiklehrer und freie Musikschulen gibt. Eine Konkurrenz durch subventionierte kommunale Angebote müsse vermieden werden.
Volkshochschulen sollten sich auf ihren Bildungsauftrag konzentrieren, so der BdSt. „Kurse, die der Freizeitgestaltung dienen, sollten nur dann angeboten werden, wenn sie eine volle Kostendeckung erzielen.“ Zudem sollten sich Stadtbüchereien mit digitalen Medien und Fernleihe-Angeboten an den aktuellen Bedarf anpassen. Sie böten sich auch als geeignete Orte für kulturelle Veranstaltungen sowie Kurse der Musik und Volkshochschulen an.
Ein weiterer Ratschlag: „Dorfgemeinschaftshäuser sollten in die Trägerschaft privater Vereine und Organisationen übergehen.“ Außerdem sei bei der Suche von Sponsoren für Kultur- und Bildungsaufgaben darauf zu achten, dass es sich tatsächlich um privatwirtschaftliche Gelder handelt und nicht der Gebührenhaushalt von öffentlichen Einrichtungen (zum Beispiel der eigenen Stadtwerke) belastet wird.
Kapitel 4: Kinder, Jugend und Sport
Unübersehbar werden die Kosten der Kinderbetreuung zu einer immer größeren Belastung für die Kommunalhaushalte. Der von den Eltern angemeldete Bedarf steigt. Das gilt sowohl für das Alter der Kinder (U3, „Krabbelgruppen“) als auch für die angebotenen Betreuungszeiten, um es beiden Elternteilen zu ermöglichen, einer Berufstätigkeit nachzugehen.
Kinderbetreuung
Laut BdSt sollte sich das Kinderbetreuungsangebot an einem tatsächlichen Bedarf orientieren. Dazu sind die Daten der Bevölkerungsentwicklung und Abfragen bei den Eltern regelmäßig zu aktualisieren. Vorübergehende Bedarfsspitzen (zum Beispiel durch die Erschließung eines Neubaugebietes) sollten in Kooperation mit Nachbargemeinden sowie einer befristeten Anhebung der Gruppengrößen über die Regelgrenzen hinaus abgefedert werden.
Der Bund der Steuerzahler rät dazu, die Kinderbetreuung grundsätzlich über Elterngebühren mitzufinanzieren, die sich anteilig an den Kosten der in Anspruch genommenen Leistungen orientieren. Für einkommensschwache Eltern könnten Beitragsstaffeln beschlossen werden, die im Sinne des Leistungsfähigkeitsprinzips „gerechter“ wären als Gebührensenkungen für alle. Die Kommunen sollten einen bedarfsgerechten Mix unterschiedlicher Betreuungsangebote vorhalten, weil nicht alle Eltern eine Ganztagsbetreuung wünschen.
Tagesmütter und andere Betreuungseinrichtungen können für die Kommune günstiger sein als Vollzeit-Kita-Plätze. Die Trägerschaft der Kinderbetreuungsangebote sollte nach Möglichkeit an Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege übertragen werden. Bei der Kostenabrechnung sollten mit den Trägerverbänden einheitliche Kosten-Leistung-Nachweise vereinbart werden.
„In einigen Bundesländern und Landkreisen gibt es Standardkostenmodelle, die als Obergrenze der Finanzierung anzusehen sind. Kosten für besondere pädagogische Konzepte (zum Beispiel Waldpädagogik oder mehrsprachige Betreuung), die über die Standardkosten hinausgehen, sind vollständig durch die Eltern zu tragen. Bei der Betreuung von Kindern aus anderen Kommunen ist ein vollständiger Kostenausgleich auf Basis der Standardkosten vorzusehen“, lauten weitere Vorschläge.
Verpflegung
Für die Mittagsverpflegung sei die Lieferung durch externe Großküchen bei Vollkostenbetrachtung meist günstiger als eine eigene Zubereitung, die erhebliche Anforderungen an die Einrichtung stellt. Soll die Verpflegung in einer eigenen Mensa frisch zubereitet werden, könne diese von mehreren Einrichtungen der Gemeinde genutzt werden (weitere Kitas, betreute Grundschule usw.).
Personalbemessung
Laut BdSt sollte bei der Personalbemessung die Mindestausstattung der Maßstab sein. Dies gelte auch für die Freistellung von Leitungspersonal, das bedarfsweise als Vertretung für die Gruppenbetreuung einzusetzen ist. Durch geeignete Gestaltung könnten Außenspielbereiche der Kitas gleichzeitig auch als öffentliche Spielplätze genutzt werden und umgekehrt. Eine kommunale Platzbörse sei in der Lage, für eine optimale Ausnutzung der Kita-Kapazitäten zu sorgen.
Jugendhilfe
Stichwort Jugendhilfe: Vor allem an sozialen Brennpunkten kann eine zielgerichtete Jugendhilfe erfolgreich dabei helfen, Kriminalität zu vermeiden, junge Menschen aus „Sozialhilfekarrieren“ herauszuführen und ihnen eine Perspektive für ein durch eigenes Einkommen finanziertes Leben zu eröffnen. Daneben gilt es, Jugendliche vor Gewalt zu schützen und ihnen Bildung sowie eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, wenn die Eltern dies nicht leisten können. Soweit möglich, sollte ambulanten Hilfen und der Unterbringung in Pflegefamilien der Vorzug vor stationären Einrichtungen gegeben werden. Dies diene nicht nur der Kostenersparnis, sondern auch einer besseren individuellen Integration.
Der BdSt rät dazu, die individuelle Hilfeplanung immer strikt von der Trägerschaft für Hilfeeinrichtungen zu trennen, damit kein Anreiz besteht, die Einrichtungen des eigenen Trägers durch zusätzliche Zuweisung von Hilfebedürftigen zu stärken. Die Entscheidung über konkrete Maßnahmen und Eingliederungshilfen müsse stets durch die zuständige Behörde getroffen und dürfe nicht auf externe Trägerausgelagert werden, die keine Budgetverantwortung tragen.
Die Anbieter von stationären, teilstationären und ambulanten Hilfsmaßnahmen sollten nach öffentlicher Ausschreibung ausgewählt werden, die auch eine Erfolgskomponente nach der Zielsetzung der Hilfeplanung enthält. Die konkrete Arbeit in allen Hilfeeinrichtungen sei regelmäßig durch eigenes fachkundiges Personal der zuständigen Behörde zu überprüfen.
Offene Jugendarbeit
Die offene Jugendarbeit in einer Kommune sollte nach Möglichkeit an private Träger übertragen werden. Eingesetzt werden könnten auch Ehrenamtliche und Personal, das den Bundesfreiwilligendienst oder ein freiwilliges soziales Jahr ableistet. Zudem gelte es, offene Jugendarbeit und Schulsozialarbeit aufeinander abzustimmen. Für die freie Nutzung offenstehende Sport und Freizeitangebote, wie etwa Skaterparks, Basketballfelder oder Bolzplätze trügen oft schon erheblich dazu bei, Jugendlichen eine attraktive Anlaufstelle zu bieten.
Sport
„Die Errichtung und Unterhaltung von Sportanlagen für den Amateur- und Breitensport ist als kommunale Aufgabe anzusehen. Soweit den Sportvereinen die Einrichtungen kostenlos zur Verfügung gestellt werden, müssen sie auch für Nutzer, die keine Vereinsmitglieder sind, frei zugänglich sein“, heißt es weiter.
Sportanlagen sollten möglichst multifunktional für den Schul,- Vereins- und freien Sport gestaltet werden. Eine finanzielle Förderung des Sportangebots sei grundsätzlich nicht erforderlich. Sozial benachteiligte Zielgruppen könnten besser gefördert werden, indem man ihnen Gutscheine für Mitgliedsbeiträge oder Eintrittspreise zur Verfügung stellt.
Zu den öffentlich bereitzustellenden Sportanlagen zählten auch (Sport) Schwimmbäder, nicht aber Spaß- und Erlebnisbäder oder die Bereitstellung von Saunalandschaften oder anderen Wellnessangeboten. Diese Einrichtungen müssten privaten Anbietern überlassen bleiben.
Kapitel 5: Soziales und Senioren
Bei der Gewährung von sozialen Hilfen ist zwischen Personen zu unterscheiden, die objektiv nicht dazu in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten oder plötzlich in Not geraten sind, und solchen, die mit zielgerichteten Hilfen dabei unterstützt werden können, durch eigene Arbeit Einkünfte zu erzielen. Die Hilfeansprüche für die erste Gruppe sind gesetzlich weitgehend festgeschrieben, so dass hier laut Bund der Steuerzahler in erster Linie administrative Aufgaben zu erfüllen sind. Für die zweite Gruppe lohnen sich jedoch Maßnahmen von „Fördern und Fordern“, um zu einer möglichst weitgehenden Selbsthilfe zu motivieren und zu befähigen.
Soziale Hilfen
„Soziale Hilfen sollten grundsätzlich nur nach dem Maßstab des gesetzlich Vorgeschriebenen erfolgen“, heißt es in der Broschüre. Um aufwändige Widerspruchs- und Gerichtsverfahren zu vermeiden, sei es sinnvoll, die bewilligenden Sachbearbeiter regelmäßig fortzubilden. Bei Personen, die absehbar nicht dazu in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt aus eigenen Einkünften zu bestreiten, sei das Augenmerk darauf zu legen, die Verwaltungskosten gering zu halten. Personen, bei denen keine objektiven Hindernisse bestehen, eine eigene Erwerbstätigkeit aufzunehmen, sollten dagegen sehr engmaschig begleitet und kontrolliert werden. Zudem seien Personen, die soziale Hilfen erhalten, aus pädagogischen Gründen so oft wie möglich zu eigenen Arbeitsleistungen heranzuziehen.
Der BdSt schlägt überdies vor, Anträge für besonderen Sachbedarf grundsätzlich nur nach einer Bedarfsüberprüfung mit Hausbesuch zu bewilligen. Zudem verhindere eine regelmäßige und engmaschige Kontrolle von Hilfebeziehern Missbrauch. Auch sollte eine sozialpädagogische Begleitung von Hilfebeziehern mit der klaren Zielsetzung, sie zur Aufnahme einer eigenen Arbeit zu motivieren und zu befähigen, Standard sein. „Berufliche Qualifizierungsmaßnahmen dienen nicht nur der Kompetenzerweiterung, sondern immer auch der Disziplinsteigerung mit einem gewissen Kontrolldruck. Bei Hilfeempfängern sollte ein regelmäßiger Austausch der beteiligten Behörden und Sozialversicherungen die Norm sein“, betont der Bund der Steuerzahler.
Illegale Aufenthalte müssten unverzüglich beendet werden, weil sonst die Gefahr besteht, dass weitere Personen angezogen werden, die sich ebenfalls illegal aufhalten. Kommunen könnten in engen Grenzen die Zahl der Hilfeempfänger beeinflussen: „Konsequentes rechtsstaatliches Vorgehen schreckt missbräuchliche Antragsteller ab. Eine anspruchsvolle Bauleitplanung sowie die qualitätsvolle Gestaltung des Wohnumfeldes zieht Einwohner an, die ihren Lebensunterhalt bestmöglich selbst bestreiten wollen.“
Senioren als wichtige Zielgruppe
Stichwort Senioren: Häufig werden sie in der politischen Diskussion mit Hilfebedürftigen gleichgesetzt – eine aus BdSt-Sicht „falsche Einstufung“. Da zahlreiche Senioren über hohe Einkünfte und Vermögen verfügen, stellten sie für zahlreiche Handels- und Dienstleistungsunternehmen eine zahlungskräftige Kundengruppe dar und könnten somit ihren Bedarf aus eigenen Mitteln finanzieren. Darum sollten sich aus öffentlichen Mitteln finanzierte kommunale Angebote nicht an der Altersgruppe orientieren, sondern immer an den individuellen Einkommensverhältnissen.
Für stationäre, teilstationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen existiert nach Auffassung des Steuerzahlerbundes ein ausreichendes privatwirtschaftliches Angebot. Einen Bedarf, hier kommunale Einrichtungen vorzuhalten, gebe es nicht mehr. Sozialstationen und Pflegeberatungen könnten an private Träger übertragen werden. Hier sollte die Kommune allenfalls eine koordinierende Aufgabe wahrnehmen.
Da zahlreiche Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege einen umfassenden Katalog von Freizeit- und Bildungsaktivitäten für Senioren anbieten, sollten sich die Kommunen auf koordinierende und informierende Aufgaben beschränken. Eine institutionelle Förderung von Seniorenangeboten sei in aller Regel nicht erforderlich, weil ein großer Teil der Nutzer die Kosten selbst tragen kann. Für finanzschwache Interessenten sollten deshalb besser Teilnehmergutscheine ausgegeben werden.
Die Wahl eines Seniorenbeirates ermögliche es, Initiativen und Aktivitäten auf ehrenamtlicher Basis zu steuern. Senioren seien eine wichtige Zielgruppe für Veranstalter, Sportvereine und den Einzelhandel. Darum liege eine seniorengerechte Gestaltung der entsprechenden Räumlichkeiten auch immer im Interesse der Anbieter.
Ehrenamt
Da zahlreiche „Jungsenioren“ auch mit Eintritt in das Rentenalter noch sehr leistungsfähig sind, könnten sie als ehrenamtliche Helfer für ältere Mitbürger, zum Beispiel für Fahrdienste und Besorgungen, gewonnen werden. Allgemeine Besuchs- und Betreuungsdienste würden von vielen Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege mit ehrenamtlichen Kräften angeboten. „Kommunale Finanzierungen sind hier in aller Regel nicht erforderlich“, heißt es abschließend.
Kapitel 6: Planen, Bauen und Umwelt
Die Politik ist dazu aufgerufen, die öffentlichen Haushalte nachhaltig zu sichern – nicht nur in Bund und Ländern, sondern auch bis hinein in die Kommunen. In diesem Sinne wurden in der
aktualisierten BdSt-Broschüre „Kommunalkompass – Tipps zum Sparen in der Kommune“ Vorschläge, die sich bei der Haushaltskonsolidierung bewährt haben, grundlegend überarbeitet.
Räumliche Planung und Entwicklung
Stichwort Räumliche Planung und Entwicklung: Die Bauleitplanung ist eine Kernaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung, mit der wesentliche Impulse für die Entwicklung der Gemeinde gegeben werden. Bei der Bauleitplanung sind verschiedene Behörden als „Träger öffentlicher Belange“ zu beteiligen. „Nach Möglichkeit sollten die Planungsdetails vorab mit diesen Behörden abgestimmt werden, damit es nicht zu überraschenden Stellungnahmen kommt, die zeit- und kostenintensive Umplanungen erfordern“, rät der Bund der Steuerzahler.
Bei der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sollten die Kosten der Bauleitplanung in die Grundstückspreise einkalkuliert werden. Wenn die Vermarktung durch einen Erschließungsträger erfolgt, kann man diesem auch die Erstellung der Unterlagen für die Bauleitplanung übertragen.
In großen Kommunen mit eigenen Planungskapazitäten werden immer wieder „vorsorgliche“ Planungen für Maßnahmen erstellt, die politisch noch gar nicht beschlossen sind. Häufig werden diese wieder verworfen oder müssen grundlegend überarbeitet werden. Auch hauseigene Planungsabteilungen sollten deshalb nur an Projekten arbeiten, über die es eine politische Einigung gibt.
Mit Blick auf die Bewirtschaftung und den Neubau von Gebäuden betont der BdSt: „Grundsätzlich gehört die Vorhaltung von Immobilien zur Vermietung für Gewerbe oder Wohnzwecke nicht zum kommunalen Auftrag. Diese Aufgabe kann von privaten und genossenschaftlichen Unternehmen besser erfüllt werden.“ Grundstücke, die für den Eigenbedarf der Kommunen nicht benötigt werden, dürfen nur dann gehalten werden, wenn sie zur Verwirklichung konkreter Planungsziele unverzichtbar sind. Ungenutzte Grundstücke sollten nach Möglichkeit veräußert werden. Das dient nicht nur der Mittelbeschaffung, sondern auch der Gewerbe- und Wohnraumentwicklung.
Bewirtschaftung und Neubau von Gebäuden
Da die effiziente Bewirtschaftung eigener Gebäude ein hohes Maß an Kompetenz erfordert, ist es ratsam, ein zentrales Immobilienmanagement einzuführen, das alle kommunalen Liegenschaften zentral verwaltet. Dem Immobilienmanagement sollte ein auskömmliches Globalbudget für die Bewirtschaftung und Sanierung der Gebäude zugewiesen werden. Für die Berechnung gibt es Richtwerte der Bundesbauverwaltung in Abhängigkeit von Alter, Herstellungskosten und Nutzung typischer Gebäudearten.
Für den Neubau kommunaler Gebäude gibt es unterschiedliche Finanzierungsmodelle. Von der Eigenfinanzierung bis zur Anmietung von einem privaten Investor sind verschiedene Beteiligungsformen privater Unternehmen möglich. Bei der Planung müssen die Funktionalität, die Kosten der Gebäudebewirtschaftung sowie die Langlebigkeit der Ausstattung an oberster Stelle stehen. Gestalterische Fragen sollten nur nachrangig behandelt werden.
In der Mehrzahl der Neubaufälle werden die Kommunen auf externe Planungsbüros zurückgreifen. Dennoch gehört es zu den ureigenen Aufgaben, die Bauherrenfunktion wahrzunehmen. Hierzu zählt insbesondere die ständige Ausführungs- und Budgetkontrolle. Es zahlt sich aus, hierfür eigene fachkundige Mitarbeiter mit hoher Kompetenz zu beschäftigen.
Verkehrsanlagen und ÖPNV
Stichwort Verkehrsanlagen und ÖPNV: „Bei Verkehrsanlagen gilt, dass jeder Quadratmeter nicht nur gebaut, sondern auch dauerhaft unterhalten werden muss. Daher dient eine Begrenzung der Verkehrsflächen nicht nur der einmaligen Einsparung von Investitionen, sondern auch der dauerhaften Haushaltsentlastung“, heißt es.
Die Ausgestaltung von Verkehrsanlagen mit Gehwegen, Radwegen und Querungshilfen sollte laut BdSt kritisch hinterfragt werden. So kann es – je nach örtlichen Verhältnissen – vorteilhaft sein, nur an einer Straßenseite Gehwege und Straßenentwässerung zu errichten. Ebenso kann der Fahrradverkehr auf einer entsprechend markierten Fahrbahn geführt werden. Besonders aufwändig im Bau und der Unterhaltung sind Kreuzungsanlagen, Ampeln und insbesondere Brücken. Kreisverkehre sind dauerhaft die kostengünstigste Form von Kreuzungsbauwerken.
Für die Planung von Verkehrsanlagen greifen die meisten Kommunen auf externe Ingenieurbüros zurück. Gleichwohl ist eine fachkundige Begleitung durch die Verwaltung von der Planung bis zur Abnahme unverzichtbar, um die Interessen als Bauherr zu vertreten.
Straßenbaumaßnahmen sollten mit den Kanal- und Leitungsnetzbetreibern abgestimmt werden. Gemeinsame Tiefbauarbeiten führen zu erheblichen Einsparungen. Auch bei von Ingenieurbüros durchgeführten Ausschreibungen muss darauf geachtet werden, dass diese konsequent anbieterneutral erfolgen. Von den ausführenden Firmen sind Sicherheiten für erst später festgestellte Ausführungsmängel zu leisten. Das gleiche gilt für eine Insolvenzabsicherung während der Bauphase.
Voraussetzungen für eine systematische Erhaltungsplanung sind aktuelle Straßenkataster, eine regelmäßige Zustandskontrolle und die laufende Bewertung durch Fachpersonal. Die Straßenunterhaltung durch einen eigenen kommunalen Bauhof ist nur dann zu empfehlen, wenn dieser über die notwendigen Fachkräfte und Spezialgeräte verfügt.
Beim ÖPNV-Angebot sollte das Augenmerk darauf gerichtet sein, individuelle Fahrten mit Kraftfahrzeugen zu verringern. Entsprechende Zielvereinbarungen sollten Gegenstand von Planungen und Ausschreibungen sein. Verkehrsleistungen im ÖPNV sollten regelmäßig öffentlich ausgeschrieben werden. Bei der Vergabe sind Preis und Qualitätsmerkmale zu bewerten.
Eine Sammelbeschaffung von Fahrzeugen kann die Kaufpreise deutlich senken. Hier lohnt sich die Bildung von Beschaffungs- und Werkstattverbünden.
Natur- und Landschaftspflege
Blickpunkt Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz: Der Pflegezustand der Grünanlagen ist in vielen Kommunen ein heißes Diskussionsthema. Einerseits gelten die Grünflächen als Aushängeschild, andererseits werden sie in erster Linie als Kostenfaktor betrachtet. Der Bund der Steuerzahler empfiehlt deshalb abgestufte Pflegekonzepte.
Der BdSt rät, aufwändig gepflegte Grünanlagen auf wenige herausgehobene Standorte zu beschränken, zudem sollte der überwiegende Teil der Grünflächen naturnah und pflegeleicht gestaltet werden. Für die Grünflächenpflege werden festgelegte Arbeitspläne empfohlen. In Verbindung mit einer Flächenermittlung erlauben sie öffentliche Ausschreibungen zum Kostenvergleich zwischen eigener Bearbeitung und der Vergabe an private Gartenbaubetriebe.
Eine eigene Waldbewirtschaftung lohnt sich nur bei sehr großen kommunalen Forstflächen. Bei kleineren Flächen sollten die notwendigen Forstarbeiten fremdvergeben werden. Landwirtschaftliche Flächen im Eigentum der Kommune, die nicht für die Baulandentwicklung oder als Ausgleichsflächen vorgesehen sind, sollten veräußert werden, um den Erlös zur Schuldentilgung einzusetzen.
Erkennbar zurück geht die Nachfrage nach Erdbestattungen, weshalb auch der Bedarf an Friedhofsflächen abnimmt. Entsprechend kritisch überprüft werden sollte die Flächenvorhaltung von kommunalen Friedhöfen. Gegebenenfalls sollte ein Rückbau zu extensiv bewirtschafteten Grünanlagen oder ökologischen Ausgleichsflächen erfolgen.
Ökologische Belange sind in allen kommunalen Aufgabenbereichen zu berücksichtigen. Deshalb wird empfohlen, diese in die Arbeit der Fachämter zu integrieren. Auf ein gesondertes Umweltschutzamt kann in der Regel verzichtet werden.
Ver- und Entsorgungseinrichtungen
Stichwort Ver- und Entsorgungseinrichtungen: Hier gibt es in aller Regel erhebliche Größenvorteile durch die gemeinsame Nutzung von Fachpersonal, Spezialgeräten, Notdiensten und teuren Infrastrukturanlagen. Für kleinere Kommunen ist deshalb aus Sicht des BdSt der interkommunale Zusammenschluss der Einrichtungen dringend zu befürworten. Die Notwendigkeit wird noch dadurch verstärkt, dass die einzuhaltenden Vorschriften immer komplexer und umfangreicher werden.
Insbesondere für die Lieferung von Strom, Gas und die Internetanbindung gibt es mittlerweile einen intensiven Wettbewerb. Der kommunale Auftrag beschränkt sich auf die Daseinsvorsorge und damit allenfalls auf die Bereitstellung eines Leitungsnetzes, das unterschiedlichen Leistungsanbietern zur Verfügung gestellt werden kann. Beim Bezug von Strom, Gas und Öl für den Eigenbedarf sollten kleinere Gemeinden Einkaufsgemeinschaften bilden und die Lieferverträge öffentlich ausschreiben.
Je nach topographischen Verhältnissen und der Siedlungsstruktur ist das Leitungsnetz der größte Kostenfaktor für die Kanalisation. Deshalb sollte bei aufwändigem Leitungsbau zuvor geprüft werden, ob mehrere dezentrale Abwasserkläranlagen eine wirtschaftliche Alternative darstellen.
Zurückhaltung ist bei der Gebührenkalkulation in der Abfallentsorgung geboten. Kalkulatorische Abschreibungen und Verzinsungen sind auf Basis der sog. Anschaffungswerte vorzunehmen, sofern Landesvorschriften dieses zulassen. Damit wird die Gebührenbelastung der örtlichen Einwohner und Unternehmen reduziert.
Kapitel 7: Wirtschaftsförderung und Tourismus, Allgemeine Finanzwirtschaft
Mit den Aktivitäten zur Wirtschaftsförderung und der Stärkung des Tourismus versuchen die Kommunen letztlich, direkt oder indirekt zusätzliche Steuereinnahmen zu generieren. „Allzu oft verpuffen die teuren Maßnahmen jedoch, ohne die gewünschten Effekte zu erzielen“, bemängelt der Bund der Steuerzahler. Das wirkungsvollste Instrument zur Wirtschaftsförderung sei nach wie vor die Bereitstellung geeigneter Gewerbeflächen, Verkehrswege und kommunaler Infrastruktur. Dieses Angebot spreche sich unter standortsuchenden Unternehmen ebenso herum wie die „weichen“ Standortfaktoren.
Auch erweiterungswillige Unternehmen könne man am besten am Standort halten, wenn man ihnen geeignete Gewerbeflächen, eine passgenaue Bauleitplanung und die schnelle Bearbeitung der Anträge anbieten kann, so der BdSt. Die Standortvorteile einer Kommune ließen sich über eine aktive und kostenlose Öffentlichkeitsarbeit vermitteln. Teure Kampagnen zum Standort- oder Imagemarketing seien für Kommunen in aller Regel verzichtbar. Gewerbevereine oder ähnliche Organisationen schafften es gewöhnlich, gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungen selbst zu finanzieren. Eine Beteiligung der Kommune aus Steuermitteln sei nicht erforderlich.
Beim Betrieb und der Vorhaltung öffentlicher Einrichtungen ist laut BdSt darauf zu achten, dass keine Konkurrenz für unternehmerische Existenzen entsteht. Pachtverträge, zum Beispiel für die Gastronomie in Sportstätten und Stadthallen, seien öffentlich auszuschreiben. Auch für die Stärkung des Fremdenverkehrs gelte, dass zu den öffentlichen Aufgaben nur die Bereitstellung der touristischen Infrastruktur gehört.
Unternehmerische Tätigkeiten im Tourismus, wie etwa die Vermietung von Strandkörben oder Wintersportausrüstung, müsse privaten Anbietern überlassen bleiben. Die Tourismuswerbung sei grundsätzlich Aufgabe derjenigen, die davon profitieren. Der kommunale Auftrag beschränke sich darauf, koordinierend tätig zu werden.
Für die Vermittlung von Fremdenverkehrsangeboten spielten privatwirtschaftliche Onlineportale, die sich über Vermittlungsgebühren finanzieren, eine immer größere Rolle. Eine aus Steuermitteln finanzierte „Zimmervermittlung“ sei verzichtbar.
Nach Auffassung des Bundes der Steuerzahler „wird touristische Infrastruktur zumeist nur dann aus staatlichen Programmen gefördert, wenn sie sich im Eigentum der öffentlichen Hand befindet. Durch geeignete Kooperationsmodelle ist sicherzustellen, dass der Kommunalhaushalt nicht durch Folgekosten belastet wird.“ Eine einzelbetriebliche Förderung wird grundsätzlich abgelehnt, weil damit in den Wettbewerb eingegriffen und unternehmerische Konkurrenz benachteiligt werde.
Überschätzte Möglichkeiten
Stichwort Allgemeine Finanzwirtschaft: „Die Möglichkeiten, durch innovative Instrumente der Finanzwirtschaft die Haushaltssituation spürbar zu verbessern, werden meist überschätzt“, heißt es. Viele dieser Vorschläge seien mit hohen finanziellen Risiken verbunden. Deshalb plädiert der BdSt für eine solide Aufgabenerfüllung nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Verwaltung.
Geldanlagen mit überdurchschnittlichen Renditeerwartungen seien mit hohen Risiken verbunden. Von Anlagen ohne vollständige Einlagensicherung rät der Bund der Steuerzahler ab. Strukturierte Anlageprodukte, bei denen die Rendite von wirtschaftlichen Ereignissen abhängt, die von der Kommune nicht beeinflusst werden können, seien hochriskant. Fremdwährungsgeschäfte sollten nur mit vollständiger Absicherung des Wechselkursrisikos erfolgen. Dann seien sie jedoch meist nicht mehr rentabel.
Versuche, die Zinsbelastung von Verschuldung durch Zinswetten oder Wechselkursspekulationen zu verringern, hätten bei vielen Kommunen zu erheblichen Verlusten geführt. Solche Geschäfte seien hochspekulativ und deshalb für die Verwaltung öffentlicher Gelder abzulehnen. Finanzierungsmodelle, bei denen notwendiges Vermögen veräußert wird, um es zur eigenen Nutzung zurückzumieten, könnten für die Kommunen nicht rentabel sein. Die vermeintlichen Vorteile ergäben sich zumeist durch Steuergestaltungsformen bei den Finanzierungsgesellschaften, die außerhalb der Einflussnahme durch die Kommunen liegen. Sie seien deshalb hochspekulativ.
„Mit der Beteiligung an scheinbar sicheren unternehmerischen Aktivitäten, auch im Bereich politisch gewünschter regenerativer Energien oder anderer ökologischen Investitionen, haben schon viele Kommunen hohe Verluste erzielt. Unternehmerische Beteiligungen sollten deshalb nur an Unternehmen erworben werden, die der Versorgung der eigenen Bevölkerung dienen“, rät der Bund der Steuerzahler und weist zudem darauf hin, dass alle unternehmerischen Beteiligungen der Kommune in einem Beteiligungsmanagement zusammengefasst werden sollten. Mit einem engmaschigen und strategischen Controlling könne die wirtschaftliche Entwicklung der Betriebe ständig verfolgt werden, um bei Fehlentwicklungen rechtzeitig gegensteuern zu können.
„Cash-Pooling“ diene der laufenden Liquiditätssicherung: „Die Kommune und die mit ihr verbundenen Einrichtungen zahlen Liquiditätsüberschüsse auf ein gemeinsames Konto ein und können sich hiervon bei Bedarf bedienen. Das spart Geld, weil die Inanspruchnahme teurer Kassenkredite insgesamt abnimmt. Weitere Vorteile sind möglich, wenn benötigte Kredite durch die Kernverwaltung zu günstigeren Konditionen aufgenommen werden können. Eigenbetriebe und Eigengesellschaften sind, soweit möglich, in den kaufmännisch rechnenden Kernbereich der Verwaltung zurückzuholen. Dadurch lassen sich doppelte Abschluss- und Prüfungskosten reduzieren.“
Für die laufende Haushalts- und Finanzentwicklung sollten in den Quartalsberichten Kennzahlen erarbeitet werden, um bei Planabweichungen zügig gegensteuern zu können, betont der BdSt. Die Steuerungsinstrumente, die durch die Doppik in der kommunalen Haushaltswirtschaft bereitgestellt werden, müssten konsequent genutzt werden. Dazu sei ein Berichtswesen zu entwickeln, das der Kommunalvertretung die notwendigen Entscheidungsgrundlagen bereitstellt. Alle Geschäftsvorfälle seien in der Buchführung zeitnah zu erfassen, Außenstände müssten konsequent verfolgt werden. Festgestellte Fehler bei der Erfassung der Geschäftsvorfälle seien sofort zu korrigieren. „Nur so ist ein aussagefähiges Berichtswesen möglich.“
DK
Dieser Artikel hat Ihnen weitergeholfen?
Bedenken Sie nur, welche Informationsfülle ein Abo der Bayerischen GemeindeZeitung Ihnen liefern würde!
Hier geht’s zum Abo!