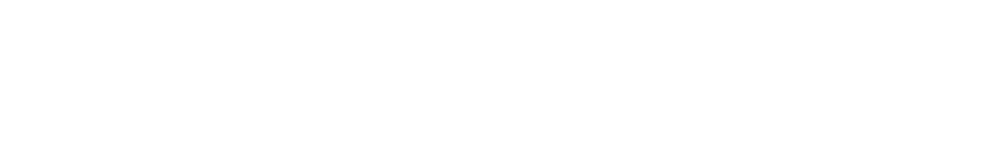| (GZ-6-2025 - 13. März) |
 |
► Bayerischer Ministerrat: |
Ambitionierte Ziele |
| Freiräume kann nur eine Verwaltung schaffen, die selbst Freiraum hat. Deshalb ist die Zahl der Verwaltungsvorschriften in Bayern deutlich reduziert worden, wie Staatskanzleichef Florian Herrmann nach einer Ministerratssitzung in München vor Pressevertretern bekanntgab. Bis zum Stichtag 31. Dezember 2024 strichen die Ministerien 519 entsprechende Vorschriften. Verglichen zum Beginn der Legislaturperiode entspreche dies einer Reduzierung von mehr als 15 Prozent, betonte Herrmann. Er sprach von einem „vollen Erfolg“, die notwendige Dynamik sei in allen Ministerien angekommen. Im Juni 2024 hatte das Kabinett beschlossen, bis Ende 2024 mindestens zehn Prozent der Verwaltungsvorschriften abzubauen. Stand 1. Januar 2025 gab es in Bayern davon noch 2.867. Außerdem gilt im Freistaat bis Ende 2026 ein Moratorium, das neue Verwaltungsvorschriften verhindern soll. Weniger Gesetze und Verordnungen Auch die Zahl der Gesetze in Bayern ist nach Angaben des Staatskanzleichefs seit 2002 kontinuierlich gesunken: „Wir hatten 2002 den Höchststand von 321 Gesetzen und mittlerweile sind es nur noch 242.“ Zudem nahm die Zahl der Rechtsverordnungen deutlich ab: von 1.209 Rechtsverordnungen im Jahr 2002 auf nunmehr 530. Passend dazu hat das Kabinett laut Herrmann auch das dritte Modernisierungsgesetz in die Verbandsanhörung gegeben. Damit soll die Entbürokratisierung weiter vorangebracht werden. Unter anderem sieht das Gesetz vor, dass Nachweispflichten im Zuwendungsrecht reduziert werden – zunächst in Form eines auf fünf Jahre angelegten Verwaltungsversuchs. Für Kleinförderungen bis 10.000 Euro und Kommunalförderungen von bis zu 100.000 Euro sind keine Nachweise über die Verwendung des Geldes mehr erforderlich. Stattdessen soll es nur noch Stichproben bei mindestens 10 Prozent der Förderempfänger geben. Betroffen sind auch Vorschriften für Umweltverträglichkeitsprüfungen: Die Grenzwerte für verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfungen bei Beschneiungsanlagen, Skipisten und Seilbahnen sowie bei der Inanspruchnahme von Biotopen würden „angemessen erhöht“, wie Herrmann mitteilte. Das EU-Recht erlaube die Änderungen; Ziel sei es, Abläufe zu beschleunigen. Entlastung für die Gemeinden Auch die Bayerische Luftreinhalteverordnung („Baumaschinen-Verordnung“) soll ersatzlos gestrichen werden. Angesichts des technischen Fortschritts würden die dortigen Grenzwerte für Feinstaub bayernweit deutlich unterschritten, so dass kein Nutzen mehr besteht. Bei der vorbeugenden Feuerbeschau wird der bisher weite Anwendungsbereich eingegrenzt. Sie soll künftig regelmäßig nur noch bei Sonderbauten (z.B. Hochhäuser, Hotels, größere Supermärkte, Spielhallen) stattfinden. Damit, so Herrmann, würden die Gemeinden und örtlichen Feuerwehren spürbar entlastet, ohne das Sicherheitsniveau über Gebühr abzusenken. Auf der Agenda des Ministerrats stand zudem die Umsetzung des Masterplans Kernfusion. Die Staatsregierung hat sich auf dem Gebiet der Kernenergie das ambitionierte Ziel gesetzt, aus Bayern heraus einen signifikanten Beitrag zur Weiterentwicklung nachhaltiger, sicherer und grundlastfähiger Technologien zu leisten. Aus ihrer Sicht ist insbesondere auf dem Gebiet der Kernfusion die Ausgangslage für innovative Impulse und Meilensteine auf dem Weg zur kommerziellen Nutzung dieser Technologie ausgezeichnet – schließlich verfüge der Freistaat über grundlegendes Know-how in vielen fusionsrelevanten Schlüsseltechnologien. Masterplan Kernfusion Eine Expertenkommission, bestehend aus Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft, hat der Bayerischen Staatsregierung nun ihre Empfehlungen zur Umsetzung des Masterplans Kernfusion vorgelegt. Sie zielen darauf ab, ein leistungsfähiges Fusionsökosystem zu schaffen und den Freistaat Bayern nachhaltig in Forschung, Ausbildung und Technologieentwicklung für die Kernfusion zu stärken. Darauf basierend erarbeitete das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst folgenden Fünf-Punkte-Plan:
Pioniere der Zukunft DK |
Dieser Artikel hat Ihnen weitergeholfen?
Bedenken Sie nur, welche Informationsfülle ein Abo der Bayerischen GemeindeZeitung Ihnen liefern würde!
Hier geht’s zum Abo!