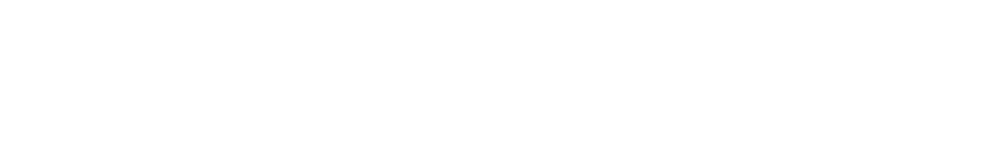| (GZ-11-2025 - 30. Mai) |
 |
► Bayerns Urmeter als Kulturgut und Symbol technischer Präzision |
Maß halten seit 150 Jahren |
Zum 150. Jubiläum der Meterkonvention gewährte das Bayerische Landesamt für Maß und Gewicht einen seltenen Blick auf eines der beiden bayerischen Urmeter. Eine fachlich fundierte und historisch faszinierende Begegnung mit einem Artefakt von europäischem Format – und bayerischer Eigenständigkeit.
 Halten gemeinsam (das) Maß, v.l.: Constanze von Hassel, GZ-Chefredakteurin, Florian Streibl, MdL und Fraktionschef derFreien Wähler Landtagsfraktion und Stefan Thums, Amtsleiter Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht.
Halten gemeinsam (das) Maß, v.l.: Constanze von Hassel, GZ-Chefredakteurin, Florian Streibl, MdL und Fraktionschef derFreien Wähler Landtagsfraktion und Stefan Thums, Amtsleiter Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht.
Am 20. Mai, dem „Tag des Messens“, öffnete Stefan Thums, Leiter des Bayerischen Landesamts für Maß und Gewicht, seine Türen für einen besonderen Gast: Florian Streibl, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Anlass war das 150-jährige Jubiläum der Meterkonvention von 1875 – ein Meilenstein internationaler wissenschaftlich-technischer Zusammenarbeit. In Bayern besitzt dieses Datum besonderen Stellenwert, denn das Königreich war früh an der Einführung des metrischen Systems beteiligt – und trat formal über das 1871 gegründete Deutsche Reich der Meterkonvention bei.
„Das Königreich Bayern hatte das metrische System bereits 1869 eingeführt und durch sein starkes Engagement im Eichwesen erhielt es zwei eigene Urmeter“, so Thums. Dabei handelt es sich um ein Strichmaß von 1889 (mit Messlinien auf einem leicht überlangen Stab) und ein Endmaß von 1897 (exakt ein Meter zwischen zwei Endflächen), gefertigt aus einer Platin-Iridium-Legierung – bis heute Symbole für höchste Messgenauigkeit.
Die Gäste erfuhren nicht nur technische Details, sondern auch überraschende historische Zusammenhänge. So wurde der Meter ursprünglich als Zehnmillionstel der Strecke vom Nordpol bis zum Äquator über Paris definiert – ein rationales Ideal der Französischen Revolution. „Das war ein Ausdruck des egalitären Denkens: gleiche Rechte, gleiche Maße“, betonte Thums. Dass ein solcher „demokratischer Maßstab“ später auch in einem Königreich wie Bayern landete, nennt Streibl augenzwinkernd „eine schöne Ironie der Geschichte“.
Eine besonders kuriose Episode berichtete Thums über den Versuch, das metrische System auch in den USA zu etablieren. Thomas Jefferson, dritter US-Präsident und überzeugter Aufklärer, hatte als Botschafter in Paris das metrische Projekt kennengelernt und wollte es in die Vereinigten Staaten bringen. „Die Franzosen sagten: Wir schicken dir einen Meterstab – samt Wissenschaftlern. Doch das Schiff geriet in Seenot, wurde von Piraten gekapert, die Wissenschaftler starben an Krankheit – und der Meterstab verschwand vorerst“, so Thums augenzwinkernd, „1889 haben die USA aber doch Kopien erhalten.“
Auch heute ist das metrische System nicht überall selbstverständlich. „Bedeutende Staaten wie die USA arbeiten noch immer mit dem imperialen System“, sagte Thums. Dass solche Unterschiede problematisch sein können, zeigt das Beispiel der NASA: „1999 zerschellte eine Mars-Sonde, weil Entwickler und Steuerteam mit unterschiedlichen Maßeinheiten rechneten. Ohne gemeinsame Sprache keine funktionierende Technik.“
Im Freistaat wird diese Sprache mit großer Präzision gesprochen – etwa bei Fertigpackungskontrollen oder pharmazeutischen Messungen. „Ob eine Softdrink-Flasche wirklich 0,5 Liter enthält, hängt von Temperatur, Dichte und der richtigen Kalibrierung ab“, erläuterte Thums. Dafür betreibt sein Amt klimatisierte Labore, in denen hochpräzise Waagen arbeiten – nicht nur für Apotheken, sondern auch für den Edelmetallhandel.
Und weil es um Bayern geht, darf ein Schluck Geschichte nicht fehlen: „Früher fasste eine bayerische Maß 1,069 Liter. Mit der Vereinheitlichung 1872 kam das Litermaß – und seitdem fehlen uns 69 Milliliter. „Bismarck hat uns bei jeder Maß ein Schluckl Bier gestohlen“, scherzt Thums.
Für Florian Streibl steht fest: „Maßeinheiten sind nicht nur eine technische Notwendigkeit. Sie stehen für Ordnung, Fairness – und am Ende auch für ein Stück Identität. Dass Bayern zwei Urmeter besitzt, ist kein Zufall, sondern Ausdruck unserer langen technischen Kulturgeschichte.“
Hintergrund: Die Meterkonvention wurde am 20. Mai 1875 von 17 Staaten unterzeichnet, darunter das Deutsche Reich. Bayern als Teilstaat war kein eigenständiger Unterzeichner, verfügte aber über eine eigene Eichverwaltung und gehörte zu den führenden technischen Akteuren im Reich. Das Bayerische Landesamt für Maß und Gewicht wurde 1869 gegründet und pflegt dieses Erbe bis heute mit großer Sorgfalt.
CH
Dieser Artikel hat Ihnen weitergeholfen?
Bedenken Sie nur, welche Informationsfülle ein Abo der Bayerischen GemeindeZeitung Ihnen liefern würde!
Hier geht’s zum Abo!