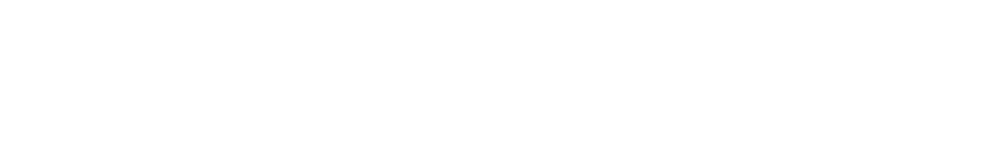|
(GZ-19-2021) |
 |
| In Kooperation mit der Sana Kliniken AG |
► Kompliziertes einfach erklärt: |
ABC des kommunalen Gesundheitswesens |
|
Fachbegriffe aus dem Gesundheitswesen - kompetent erklärt in Kooperation mit der Sana Kliniken AG. |
Diagnose Herzinsuffizienz
Zum Umgang mit einer gefährlichen Krankheit auch in Pandemie-Zeiten
Chronische Herzinsuffizienz ist in Deutschland weit verbreitet und gehört bei uns zu den häufigsten Todesursachen. Rund vier Millionen Menschen sind davon betroffen. Die Herzschwäche ist dabei eine Folge diverser Vorerkrankungen. Sie kann etwa nach einem Herzinfarkt oder nach einer Herzmuskelentzündung auftreten und die Betroffenen ein Leben lang belasten.
Schwächung des gesamten Körpers
Tückisch dabei ist, dass sich typische Symptome wie Luftnot und Leistungsschwäche, häufig schleichend über Monate und Jahre hinweg entwickeln, sodass die Erkrankten ihre Veränderung kaum wahrnehmen oder falsch bewerten. Wie der Name schon sagt, ist das Problem an der Herzschwäche, dass durch sie ausgelöst, der gesamte Körper schwächer wird. Das Herz kann nicht mehr seine volle Leistung erbringen. Dies führt bei Betroffenen schnell zu Atemnot. Zu Beginn der Erkrankungen zunächst einmal nur bei stärkeren Belastungen wie schnellem Gehen oder Treppensteigen. Bei fortschreitender Herzinsuffizienz leiden Patienten auch bei kleinen Anstrengungen unter Luftnot, Müdigkeit und Erschöpfung. Sämtliche Alltagsaktivitäten sind zunehmend eingeschränkt.
Heilbar ist die Herzschwäche übrigens meistens nicht. Moderne Untersuchungsverfahren, Medikamente und Operationsmethoden machen es allerdings möglich, die Krankheit früh zu erkennen und gezielt zu behandeln. Wobei die Prognose am besten ist, wenn man die genaue Ursache der Erkrankung herausfindet, um sie dann auch gezielt behandeln zu können. Mittlerweile stehen eine Vielzahl Medikamente zur Verfügung. Einige verbessern nachweislich die Prognose, andere lindern vor allem bestehende Beschwerden. Ihre dauerhafte Einnahme ist ebenso wichtig, wie auch die Kontrollbesuche beim Arzt – und zwar auch während des derzeitigen Pandemiegeschehens.
Denn: der Körper ist geschwächt. Nicht nur durch Atemnot. Die Lunge ist durch die Herzinsuffizienz deutlich anfälliger für respiratorische Viren, wie etwa Sars-CoV-2. Eine solche Infektion kann, wie auch andere Infektionen bei Herzpatienten eine sogenannte Entgleisung der Herzschwäche auslösen. Bereits vor der Pandemie kamen jährlich fast 500.000 Menschen aufgrund einer solchen Entgleisung ins Krankenhaus. Dabei ist diese häufig die Folge eines zusätzlichen Ereignisses, wie eine Herzrhythmusstörung, ein plötzlicher Blutdruckanstieg oder eben auch eine Virusinfektion – wie Covid-19 oder auch Influenza. Diese kann bei Menschen mit Herzschwäche schwere Komplikationen verursachen, denn die Viren bleiben nicht in den Atemwegen, sondern können sich im gesamten Körper verbreiten und so auch das Herz angreifen. Zudem ist die Lunge bei den Betroffenen besonders anfällig, da sich bei einer Herzschwäche, aufgrund der verringerten Pumpleistung, Blut in die Lunge zurückstauen kann.
Herzinsuffizienz-Patienten sollten daher gerade in Pandemiezeiten besonders auf Warnzeichen achten, ihre begonnene Behandlung konsequent fortsetzen und auf keinen Fall unterbrechen. Es sollte niemand aus Angst vor einer Ansteckung auf einen Arztbesuch verzichten, denn das könnte fatale gesundheitliche Folgen haben.
Gesundheitsvorsorge: (Darm)Krebs macht auch in Pandemiezeiten keine Pause
Jährlich erkranken in Deutschland rund 61.000 Menschen an Darmkrebs, etwa 25.000 sterben daran. Neben Brustkrebs ist Darmkrebs damit die zweithäufigste Krebserkrankung in Deutschland – und nach Lungenkrebs die zweithäufigste Todesursache. Ein Großteil der Todesfälle ließe sich jedoch verhindern. Zum einen, indem Risikofaktoren für diese Krebserkrankung, wie Nikotin- und Alkoholkonsum, Bewegungsarmut oder auch faser- und ballaststoffarme Ernährung, vermieden werden. Zum anderen, indem ab einem gewissen Alter Vorsorgeuntersuchungen regelmäßig wahrgenommen werden.
Die Darmkrebsvorsorge wird in der Regel von den mit dem Onkologischen Zentrum zusammenarbeitenden Fachärzten oder bei besonderen Situationen direkt im Klinikum angeboten. Ab einem Alter von 50 Jahren können Stuhlproben durch Untersuchung auf verstecktes Blut auf Anzeichen von Darmkrebs analysiert werden. Spätestens ab 55 Jahren sollten Frauen wie Männer eine Darmspiegelung durchführen lassen. Die sogenannte Koloskopie ist die beste Möglichkeit, Darmkrebs und seine Vorstufen mit großer Sicherheit zu erkennen. Doch seit Beginn der Coronapandemie machen deutlich weniger Menschen Gebrauch von diesem Vorsorgeangebot. Wegen einer vermeintlich höheren Ansteckungsgefahr sagen sie – trotz umfassender Hygiene- und Sicherheitsstandards in den Praxen und Kliniken – in großem Umfang Vorsorgeuntersuchungen ab. Hinzu kommt, dass die Darmkrebsvorsorge an sich viele – vor allem Männer – abschreckt, schon vor Corona. Dabei war Angst noch nie ein guter Ratgeber.
Darmkrebs bereits im Vorfeld verhindern
Denn: Die Koloskopie, deren Kosten ab einem Alter von 55 Jahren von der Krankenkasse übernommen werden, ist das wichtigstes Mittel, Darmkrebs bereits im Vorfeld zu verhindern. Bei der Darmspiegelung geht es vor allem um die Behebung von Veränderungen, aus denen heraus sich Darmkrebs entwickeln könnte. Rund ein Drittel der Patienten hat zwar keine Beschwerden, aber bereits Polypen. Diese Veränderungen können frühzeitig festgestellt und gleich entfernt werden – im besten Fall bevor Krebs entsteht. Treten Beschwerden wie Blutungen und Schmerzen im Bauch auf, ist es meist schon zu spät.
Ist der Befund unauffällig, muss die Untersuchung erst nach zehn Jahren wiederholt werden. Damit einher geht auch die große Chance, Lebensstil und Ernährung mit Blick auf die Risikofaktoren zu verbessern. Die meisten Menschen sind überrascht, wenn sie erfahren, dass beispielsweise das tägliche Glas Wein ein erhöhtes Darmkrebsrisiko verursacht. Es lohnt sich demnach – nicht nur in Pandemiezeiten – auf seinen Lebensstil zu achten und damit auch weitere Erkrankungen, wie Herzinfarkt oder Diabetes zu verhindern.
Impfungen
Die Impfung ist nicht erst seit Corona ein vieldiskutiertes Thema. Als wichtiger medizinischer Baustein gegen schwere Erkrankungen - oft als „Kinderkrankheiten“ verharmlost - sind Impfungen etwa gegen Windpocken, Röteln, Masern oder Mumps seit Jahrzehnten etabliert, aber dennoch nicht unumstritten. Die Gruppe der Impfgegner ist zwar zahlenmäßig klein, dafür aber in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich lauter.
In der aktuellen Situation ist es Wissenschaftlern gelungen, rasch eine Impfung gegen Covid-19 zu entwickeln. Die Produktion der Impfstoffe läuft und auf einer schnellen Durchimpfung ruht in allen Teilen der Welt - unabhängig von den handelnden Personen in Regierung und Wissenschaft - die Hoffnung, dass die meisten Einschränkungen dieser Tage bald wieder aufgehoben werden können.
Sicherheit und Nebenwirkungen
In Sachen Sicherheit und Nebenwirkungen sind die Wissenschaftler überzeugt, ein sicheres Produkt entwickelt zu haben und die wenigen bislang bekannt gewordenen Fälle von Schmerzen an der Einstichstelle, Schüttelfrost oder Fieber bestätigen dies. Wahrscheinlich ist, dass die vorhandenen Impfstoffe die derzeit bekannten Mutationen des Corona-Virus ebenfalls abdecken. Ob das auch künftig so sein wird, ist schwer zu sagen, aber das war in der derzeitigen Situation auch bestimmt nicht das vordringliche Ziel – gegen das Grippevirus muss man schließlich auch jedes Jahr aufs Neue geimpft werden, weil Mutationen davon auftreten – und auch hier gibt es eine hohe Impfbereitschaft und nur marginale Nebenwirkungen.
Impfzentren und Impfteams
Das Vorgehen bei den Impfungen, die Art der Terminvergabe und die Geschwindigkeit der Umsetzung variieren je nach Bundesland. Impfzentren sind vielerorts das Mittel der Wahl; Impfteams sind unterwegs und in vielen Fällen wird auch im Krankenhaus geimpft. Die Menge der bereits verimpften Dosen variieren je Bundesland und auch die Impfbereitschaft schwankt bei denjenigen, die derzeit geimpft werden könnten.
Die Bekämpfung des Corona-Virus hat und wird uns auch weiterhin eine Menge Geduld abverlangen. Aber anders als im vergangenen Jahr ist mit dem Impfstoff nun ein Licht am Ende des Tunnels angegangen, das jeden Tag ein wenig heller wird.
Intensivbett
Die Intensivstation gehört neben der Geburtshilfe und der Notaufnahme zu jenen Stationen, die aus Sicht der Öffentlichkeit aus einem Krankenhaus nicht wegzudenken sind. Auf ihr werden Patienten behandelt, die nach einem Unfall oder als Folge einer Erkrankung beatmet werden müssen oder deren Kreislauf instabil ist und deshalb eine permanente Überwachung erforderlich macht.
Neben der „klassischen“ Intensivstation (ITS) haben sich weitere Überwachungsstationen in Deutschlands Krankenhäusern etabliert, etwa die „IMC“ (eine Art Überwachungsstation mit nicht ganz so komplexen Fällen wie auf der ITS) oder die „Stroke Unit“ (auf der vor allem Patienten mit Schlaganfällen betreut werden).
Durch die Behandlung der Corona-Patienten mit einem schweren Verlauf hat das Intensivbett in den vergangenen zwölf Monaten eine massive mediale Aufwertung erfahren – nachdem zuvor die Politik durch zahlreiche regulatorische Maßnahmen damit begonnen hatte, diese Versorgungsform stärker einzuhegen und auf größere bzw. zentrale Standorte zu fokussieren.
Denn zum einen gab es – vor Corona – recht unterschiedliche Auffassungen über die Belegungsquote, die notwendig ist, um eine solche Station überhaupt betreiben zu können. Zum anderen fehlte es (und fehlt eigentlich auch immer noch) an ausreichend qualifiziertem Personal. Zusätzlich hatte das Bundesministerium für Gesundheit eine Pflegepersonaluntergrenze für Intensivstationen eingeführt und diese während des vergangenen Jahres ausgesetzt.
Inzwischen ist die Regelung allerdings wieder in Kraft und Krankenhäuser, die die vorgeschriebene Personaluntergrenze nicht gewährleisten können, müssen mit Sanktionen rechnen.
Ebenfalls komplexitätserhöhend gestaltet sich der Umstand, dass für viele medizinische Behandlungen in den Krankenhäusern eine Intensivstation als „Back-Up“ vorgehalten werden muss – bestimmte Eingriffe also nur vorgenommen werden können, wenn ein entsprechendes Intensivbett für den Notfall vorhanden ist.
Dies gilt freilich nicht für alle Krankenhausleistungen, die Forderungen nach einem Intensivbett für den Fall der Fälle erhöht jedoch vor allem für kleinere Krankenhäuser die Kosten und den Aufwand. Denn bei vielen Eingriffen wiederum werden Mindestmengen definiert, die im Jahr erreicht werden müssen, damit die Eingriffe überhaupt abgerechnet werden.
Damit kommt dem Bett auf der Intensivstation im Gesamtgefüge Krankenhaus eine ganz besondere Rolle zu:
Einerseits ist es ein oftmals medizinisch notwendiges Aushängeschild, dessen Betrieb (außerhalb der Pandemie) durchaus teuer erkauft werden muss. Andererseits stehen ihm regulatorische Maßnahmen gegenüber, die auf eine stärkere Zentralisierung der Intensivmedizin und der damit verbundenen medizinischen Eingriffe abzielen.
Die politisch beabsichtigten Veränderungen in der Krankenhausversorgung werden nach Corona wieder an Fahrt aufnehmen. Damit eng verwoben: die Frage, welche Rolle die Intensivstation in kleineren Krankenhäusern spielen wird.
Long-Covid: Genesen und doch nicht gesund
Die Wohnung liegt im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses – bis vor Kurzem kein Grund zur Sorge. Doch auf einmal wird selbst der Gang vom Briefkasten zur Wohnungstür zur Herausforderung. Die Namen der Kollegen, mit denen man seit Jahren eng zusammenarbeitet, waren nie ein Problem. Jetzt fallen sie plötzlich vom einen auf den anderen Moment nicht mehr ein.
Jeder zehnte Covid-19-Betroffene kämpft im Anschluss an seine akute Erkrankung mit langanhaltenden gesundheitlichen Problemen. Vom sogenannten Long-Covid-Syndrom sind in Deutschland etwa 350.000 Menschen betroffen. Sie entwickeln Symptome wie ständige Erschöpfung, Luftnot, neurologische Störungen, starken Schwindel oder Verlust der Geschmacksfunktionen der Zunge oder auch des Geruchssinns. Das Coronavirus gilt als Multiorganvirus, das nicht nur in der Lunge, sondern auch in zahlreichen anderen Organen auftreten kann – so etwa in der Niere, der Leber, dem Herz oder auch dem Gehirn. Die bislang beobachteten Spätfolgen werden daher nicht als einheitliches Phänomen betrachtet, sondern als verschiedene Krankheitsbilder, die sowohl zeitversetzt als auch parallel in verschiedenen Ausprägungen auftreten können.
Besonders tückisch: Alter und Vorerkrankungen scheinen keine größere Rolle dabei zu spielen, ob Erkrankte anhaltende Symptome entwickeln. Post-Covid-Betroffene finden sich in allen Altersklassen, viele waren vor ihrer Erkrankung sportlich aktiv und hatten keinerlei Vorerkrankungen.
Neue Post-Covid-Ambulanzen
Um Betroffenen zu helfen und gleichzeitig weitere Erkenntnisse über die Spätfolgen von Covid-19 zu erhalten, sind in ganz Deutschland Post-Covid-Ambulanzen entstanden. Patienten werden dort oftmals über mehrere Monate hinweg von einem multiprofessionellen Team begleitet. Aufgrund der Vielschichtigkeit der Spätfolgen gehören nicht nur Internisten und Lungenfachärzte zum Behandlungsteam, sondern auch Neurologen, Kardiologen sowie Psychologen. Gerade auch die Psyche ist ein wichtiger Aspekt, der bei der Behandlung von Erkrankten im Blick gehalten werden sollte. Symptome wie gesteigerte Ängstlichkeit, Konzentrationsstörungen oder auch eine Depression können eine direkte Folge der Infektion sein.
Mehr als ein Jahr nach Auftreten des Coronavirus in Deutschland ist auch die Krankheitsentstehung von Long-Covid noch Gegenstand der Forschung, in der viele Experten aktiv sind. Festzuhalten bleibt jedoch: Viele – vor allem junge – Patientinnen und Patienten können sich folgenlos von den Symptomen eines Post-Covid-Syndroms erholen.
Der Mensch im Mittelpunkt
In der Industrie läuft ohne ihn gar nichts, und auch im Alltag trifft der Mensch immer häufiger auf Roboter. Seltener sind sie im Krankenhaus zu finden – wenngleich Roboter auch dort inzwischen durchaus eine wichtige Rolle spielen. Insbesondere in der Urologie kommen sie schon länger zum Einsatz, namentlich bei der Behandlung von Prostatakarzinomen. Denn dort kommt es bei einem Eingriff durchaus auf Bruchteile eines Millimeters an und im Gegensatz zum Menschen kann ein Roboter das Skalpell vollständig ruhig halten – das erhöht die Chance, die Funktionsfähigkeit der das Organ umgebenden Nervengeflechte nach dem Eingriff zu erhalten.
Operierende Roboter: Eine lohnende Investition?
Moderne Technik mit einem großen Nutzen für die Patienten: Klingt, als ob solche Geräte längst Standard sein müssten in Deutschlands Krankenhäusern. Aber das ist nicht der Fall. Denn ein Einsatz sollte gut durchdacht werden, schließlich muss sich die hohe Investition ja lohnen. Dies ist allerdings oft nicht der Fall, denn weil die Kassen nur den „klassischen“ Eingriff bezahlen, fallen für die Krankenhäuser hohe Zusatzkosten an.
Zu beachten ist zudem, dass ein Eingriff mit einem Roboter meist länger dauert, was Folgen für die Dosierung der Narkosemittel hat und somit das (allerdings geringe) Risiko des Patienten auf Folgeschäden erhöht. Zur Abwägung gehört schließlich auch, dass die Ergebnisqualität der Eingriffe statistisch gesehen relativ identisch ist – ein Roboter also einen guten Job macht, allerdings eben auch keinen besseren, als ein erfahrener Operateur. Ein Roboter macht aus einem durchschnittlichen Chirurgen eben keinen hervorragenden.
Überhaupt kommt es bei dem Eingriff via Roboter vor allem auf den Menschen an. Denn natürlich muss ein OP-Team mit einem Arzt an der Steuerung den Eingriff begleiten, um bei unvorhergesehenen Ereignissen eingreifen zu können. Man darf deshalb nicht an vollautomatisierte Produktionslinien in der Industrie denken, wenn man sich den Einsatz eines Roboters im Operationssaal vorstellt. Der Mensch steht dort nach wie vor im Mittelpunkt, die Maschine wird von ihm gelenkt.
Ob man einen Roboter für das eigene Krankenhaus anschaffen sollte, ist also eine Frage der Abwägung. Weil immer mehr Patienten danach fragen, natürlich die Perspektive im Raum steht, das Gerät irgendwann auch für andere Eingriffe verwenden zu können und schließlich auch das medizinische Personal seine Jobwahl heute durchaus damit verbindet, welche technischen Möglichkeiten der Arbeitsplatz bietet, sollte eine Anschaffung immer nach sorgfältiger Abwägung erfolgen.
Hier kann es helfen, mit Experten zu sprechen, die Unternehmen bei solchen Entscheidungen beraten oder selbst bereits mit entsprechenden Robotern arbeiten. Zudem muss eine solche Investition stets in die Medizinstrategie des Krankenhauses passen:
Wer sich als regionaler Grundversorger im ländlichen Raum positionieren will, muss sicher anders mit dieser Frage umgehen als ein Haus, das als Spezialist für urologische Eingriffe wahrgenommen werden will.
Die überlastete Notaufnahme
Einst geschaffen, um Patienten in Notfallsituationen zu versorgen, hat sich die Notaufnahme in den vergangenen Jahren zu einem allgemeinen und „unkomplizierten“ Anlaufpunkt vieler Menschen mit vergleichsweise harmlosen Symptomen entwickelt. Die vermeintlichen Annehmlichkeiten liegen dabei für den Patienten auf der Hand: keine lästige Terminvergabe beim Haus- oder Facharzt, effektive Diagnostik durch eine breite medizinische Expertise und neueste Medizintechnik mit der Möglichkeit zur direkten therapeutischen Intervention.
Das abhanden gekommenen Gefühl, wann es sich wirklich um einen Notfall handelt und wann der Gang zum niedergelassenen Arzt ausreichend ist, führt mitunter zu grotesken Situationen: Da trifft ein dringend zu versorgender Herzinfarktpatient auf jemanden, der vor drei Tagen einen mutmaßlich banalen Hautauschlag hatte. Mittlerweile ist dieser gar nicht mehr sichtbar. Allein der Patient vermag sich an den quälenden Juckreiz zu erinnern. Situationen wie diese überlasten das System. Denn sie behindern Ärzte und Pflegekräfte bei ihrer eigentlichen Aufgabe – akute medizinische Notfälle zu versorgen. Sie kosten Zeit, die etwa bei einem Herzinfarkt oder Schlaganfall entscheidend sein kann.
Auch in der aktuellen Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass die Notaufnahmen vor allem in den Abend- und Nachtstunden sowie am Wochenende das „last resort“ für viele Menschen bleiben. Dabei ist die sogenannte Fallschwere der Erkrankungen in den vergangenen Monaten gestiegen. Zögerten zu Beginn der Pandemie Patienten mit bedrohlichen Symptomen, die beispielsweise auf einen akuten Schlaganfall oder Herzinfarkt hindeuten, den Notruf zu wählen, aus Angst sich mit Covid-19 anzustecken, ist dies im Verlauf der Pandemie zurückgegangen. Deutlich gestiegen sind jedoch die organisatorischen Aufwände zur Einhaltung allerhöchster Hygienestandards. Aufwendige Testungen bei Krankenhauspersonal wie auch Patienten und die Vorhaltung umfangreicher Isolations-Maßnahmen erfordern viel Zeit und führen zu einer weiteren Erhöhung des Arbeitsvolumens. Hinzu kommen Personalausfälle durch Infektionsgeschehen.
Notfallambulanzen kommen an ihre Grenzen
Die vergangenen Monate haben gezeigt, was bereits vor Corona offensichtlich war: das System der Notfallversorgung kommt an seine Grenzen. Die Notfallambulanzen landauf landab haben Jahr für Jahr immense Kosten. Spezialisten, die sich in der Rettungsstelle verfügbar halten müssen, können nicht für geplante Operationen eingesetzt werden. Patienten solcher sogenannten Elektiv-OPs, wie beispielsweise Knie- oder Hüftgelenkoperationen, müssen längere Wartezeiten in Kauf nehmen.
Eines wird daher im Mittelpunkt einer intelligenten und zukunftsgewandten Notfallversorgung stehen müssen: die Sicherstellung des Versorgungsauftrags vor Ort. Hierfür ist es entscheidend, die Herausforderungen im Management von Notaufnahmen zu kennen und darauf mit der richtigen Qualität reagieren zu können. Beispielsweise durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Niedergelassenen, um die sogenannten „leichten Fälle“ sukzessive aus der Notaufnahme in ambulante Strukturen zu überführen.
Auf dem Weg zum „Smart Hospital“
Verbesserung der Patientenversorgung und die Erhöhung der Patientensicherheit dank digitaler Lösungen im Krankenhausalltag
Spätestens seit Inkrafttreten des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) Oktober 2020 ist klar, dass die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen im vollen Gange ist. Und das ist gut so, bedenkt man, dass der Nachholbedarf enorm ist und darüber hinaus auch die breitere Gesellschaft Forderungen in diese Richtung stellt.
Aus diesen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen erwachsen nun Anforderungen an die Betreiber von Krankenhäusern, die einen eklatanten Aufholbedarf in Sachen Digitalisierung aufweisen. Wohl dem, der sich frühzeitig mit dem Themenkomplex befasst und entsprechende Strukturen bereits geschaffen hat. Einige positive Beispiele sind das Universitätsklinikum Essen, das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, aber auch die Sana Kliniken, die sich proaktiv mit Fragen wie der Prozesssteuerung durch Echtzeitdaten, App-basierten klinischen Anwendungen, vernetzten Geräten und Biosensorik sowie dem Einsatz von künstlicher Intelligenz und vielen weiteren Technologien befassen.
Dass einige dieser Themen längst keine Zukunftsvision, sondern vielmehr gelebter Alltag sind, sollen einige Projektbeispiele der Sana Kliniken AG zeigen.
Exemplarisch ist hier das bei der Sana im Einsatz befindliche Lösungsportfolio des Schweizer Unternehmens imito AG, bei dem es vorrangig um mobile Lösungen zur Wunddokumentation geht. Mit imitoWound erfolgt das Erstellen von Wundbildern mit automatischer Vermessung der Wundfläche und integrierten Formularen zur Dokumentation ganz einfach per Smartphone-App. Das spart Zeit und verbessert zudem die Dokumentations- und Versorgungsqualität.
Für ebenso effiziente Prozesse und einen optimierten Ressourceneinsatz im Klinikalltag sorgt in sämtlichen Sana Kliniken in Nordrhein-Westfalen die modular aufgebaute offene IoT- Plattform von simplinic. Dort werden Medizingüter wie Krankenhausbetten, mobile Medizingeräte oder auch Hilfsmittel mittels Bluetooth-Low-Energy in Echtzeit raumgenau lokalisiert, ausgelesen und über die digitale Plattform in einem Dashboard aggregiert angezeigt – um in der Folge Prozesse faktenbasiert in Echtzeit zu steuern.
Ein weiteres Beispiel ist die Patienten-App „MeineSana“, die bereits in mehreren Sana Kliniken angeboten wird. Sie begleitet Patientinnen und Patienten vor, während und nach ihrer Behandlung zielgerichtet mit den richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt. Über die App erhalten Patienten unter anderem Tipps zur Vorbereitung für den Krankenhausaufenthalt, werden während der Behandlungszeit an Termine erinnert oder erhalten Informationen über Ihre Erkrankung.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass wenngleich viele digitale Baustellen in deutschen Krankenhäusern bestehen, es trotzdem bereits heute möglich ist, durch disruptive digitale Lösungen Verbesserungen für das Personal, die Patienten und den Betrieb zu erzielen. Klar ist aber auch, dass dies nicht auf einen Schlag geschehen kann, sondern trägerunabhängig ein langfristiger Prozess ist, der neben technischen auch viele kulturelle, organisatorische, und finanzielle Herausforderungen bereithält. Der Weg ist noch weit, aber die Richtung stimmt – und das KHZG kann als Stütze dienen.
Systemwechsel im Pflegebudget: Die Ausgliederung der Pflegekosten aus dem DRG-System
Die Krankenhausfinanzierung gehört zu den komplexesten Themen des deutschen Gesundheitswesens. Sie erfolgt nach dem Prinzip „dualen Finanzierung“. Dabei werden die Betriebskosten eines einzelnen Krankenhauses, also die Kosten, die für die Behandlung eines Patienten entstehen, von den Krankenkassen finanziert. Für die Investitionskosten hingegen kommen die Bundesländer auf. Die Vergütung für somatische, also den Körper betreffende, Behandlungen erfolgt dabei über das DRG-System (Diagnosis Related Group).
Mittelpunkt dieses Systems ist der sogenannte Fallpauschalenkatalog, der über 1.200 abrechenbare Fallpauschalen enthält, die das komplexe Behandlungsgeschehen in einem Krankenhaus abbilden. Dabei wird der Basispreis für eine einzelne DRG-Leistung über Landesbasisfallwerte festgelegt, die jährlich von den Krankenhausgesellschaften und den Krankenkassen auf der jeweiligen Landesebene verhandelt werden. Seit 2020 werden die Kosten des Pflegepersonals in der unmittelbaren Patientenversorgung, der sogenannten „Pflege am Bett“, nicht mehr über die Fallpauschalen vergütet. Grundlage hierfür ist das Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG) mit dem beschlossen wurde, die Krankenhausvergütung auf eine Kombination aus Fallpauschalen und Pflegekostenvergütung (Pflegebudget) umzustellen. Sein individuelles Pflegebudget muss jedes Krankenhaus nun direkt mit den Kostenträgern verhandeln – im Rahmen der jährlichen Entgeltverhandlungen.
Die Abgeltung der Pflegekosten erfolgt fallbezogen über einen krankenhausindividuellen Pflegeentgeltwert und die Pflege-Bewertungsrelation pro Tag. Diese Bewertungsrelation wird für jeden Abrechnungsfall mit der jeweiligen Verweildauer des Falles und dem individuellen Pflegeentgeltwert multipliziert. Das Ergebnis dieser Berechnung entspricht dem Geldbetrag pro Fall (Pflegeerlös), der zusätzlich zur bisher bereits geltenden Bewertungsrelation der DRG abgerechnet wird.
Das neu eingeführte Pflegebudget wird auf Grundlage der geplanten und nachgewiesenen Pflegepersonalausstattung sowie der krankenhausindividuellen Kosten ermittelt. Bis zur erstmaligen Vereinbarung eines krankenhausindividuellen Pflegebudgets gilt ein gesetzlich festgelegter vorläufiger Pflegeentgeltwert.
Eine Herausforderung des neuen Systems ist die fehlende Vergleichbarkeit des G-DRG-Systems aus 2019 mit dem aG-DRG-System 2020. Während das „alte“ System noch unter Berücksichtigung der Pflegekosten in vollem Umfang berechnet wurde, kommen diese im „neuen“ System nur noch teilweise zum Tragen. Inwieweit die ausgegliederten Pflegekosten für eine Klinik einen Verlust oder einen Gewinn gegenüber der bisher geltenden Abrechnungssystematik darstellen, wird zentral von der Ausgestaltung der Verhandlungen vor Ort und auch der individuellen Ausstattung mit Pflegekräften in der jeweiligen Klinik abhängen.
Trägervielfalt in der Krankenhausversorgung
Die Krankenhauslandschaft ist unübersichtlich geworden - vor allem dann, wenn man sich die Gesamtentwicklung in Deutschland ansieht. Verschiedene Träger, Gruppen und Konzerne tummeln sich hier und stellen die medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sicher. Vor der eigenen Haustür, im eigenen Landkreis ist es oft kaum einfacher: das kommunale Krankenhaus, das seit Jahr und Tag vom Landkreis betrieben wird, in der Nachbarschaft eine privatisierte orthopädische Fachklinik und ein paar Häuser weiter eine Privatklinik, in der alle Fragen der ästhetischen Chirurgie beantwortet werden. Dazu ein loser Verbund über die Landkreisgrenzen hinweg und über allem schwebt der große Schatten der Universitätsklinik in der Großstadt um die Ecke.
Die Frage der Trägerschaft ist dabei eigentlich am einfachsten zu beantworten: Entweder ist das Haus „kommunal“ - dann also im Besitz der Kommune. Oder frei-gemeinnützig, dann gehört das Haus einer Kirche, einem konfessionellen Verband wie etwa AWO oder Diakonie. Oder schließlich Privat - dann ist das Haus im Besitz eines großen Klinikverbundes wie etwa der Sana Kliniken AG. Für diese drei Trägerformen gilt: Sie alle behandeln alle Bürgerinnen und Bürger in einem Landkreis - der Versicherungsstatus spielt keine Rolle. Anders bei Privatkliniken: Hier gibt es eine breite Trägervielfalt (bis hin zum persönlich haftenden Arzt) und hier gilt das Selbstzahlerprinzip: für die neue Nase zahlt man selbst.
Zudem gibt es Mischformen: Private steigen als Minderheitsbeteiligung in ein kommunales Haus ein oder bieten einen Managementvertrag an, also die Möglichkeit, ein kommunales Haus ohne Veränderung in der Besitzerstruktur von einem erfahrenen externen Manager führen zu lassen. Denkbar sind auch Verbünde: Häuser aus einer Region kooperieren auf unterschiedlichsten Ebenen und auf unterschiedlichsten Niveaus. Schließlich gibt es auch kommunale Zusammenschlüsse, durchaus über Landkreisgrenzen hinaus - mit allen damit verbundenen Chancen, aber eben auch Risiken.
Unabhängig von der Form der Trägerschaft ist wichtig, denn die Bedingungen für den wirtschaftlichen Betrieb eines Krankenhauses haben sich nicht erst seit Corona verschlechtert und werden dies auch weiterhin tun. Patienten wandern ab, die Behandlungsmethoden verändern sich und längst geht es nicht mehr um die Zahl der Betten, die vorgehalten werden, sondern um eine intelligente und zukunftszugewandte Gesundheitsversorgung.
Künftig wird es deshalb weniger um die Frage gehen, wem das Krankenhaus gehört. Vielmehr wird man fragen müssen, ob es sich wirtschaftlich betreiben lässt, ob man es führen lassen sollte oder ob eine Kooperation mit Dritten sinnvoll sein kann. Denn die Erfahrung zeigt: Menschen ist eine umfassende medizinische Versorgung wichtig - unabhängig davon, wer sie betreibt und ob sie für diese Versorgung eventuell ein paar Kilometer weiter fahren müssen.
Sie haben Anregungen für unser Kommunal-ABC?
Senden Sie bitte eine Nachricht an news@gemeindezeitung.de. Vielen Dank!
Dieser Artikel hat Ihnen weitergeholfen?
Bedenken Sie nur, welche Informationsfülle ein Abo der Bayerischen GemeindeZeitung Ihnen liefern würde!
Hier geht’s zum Abo!